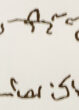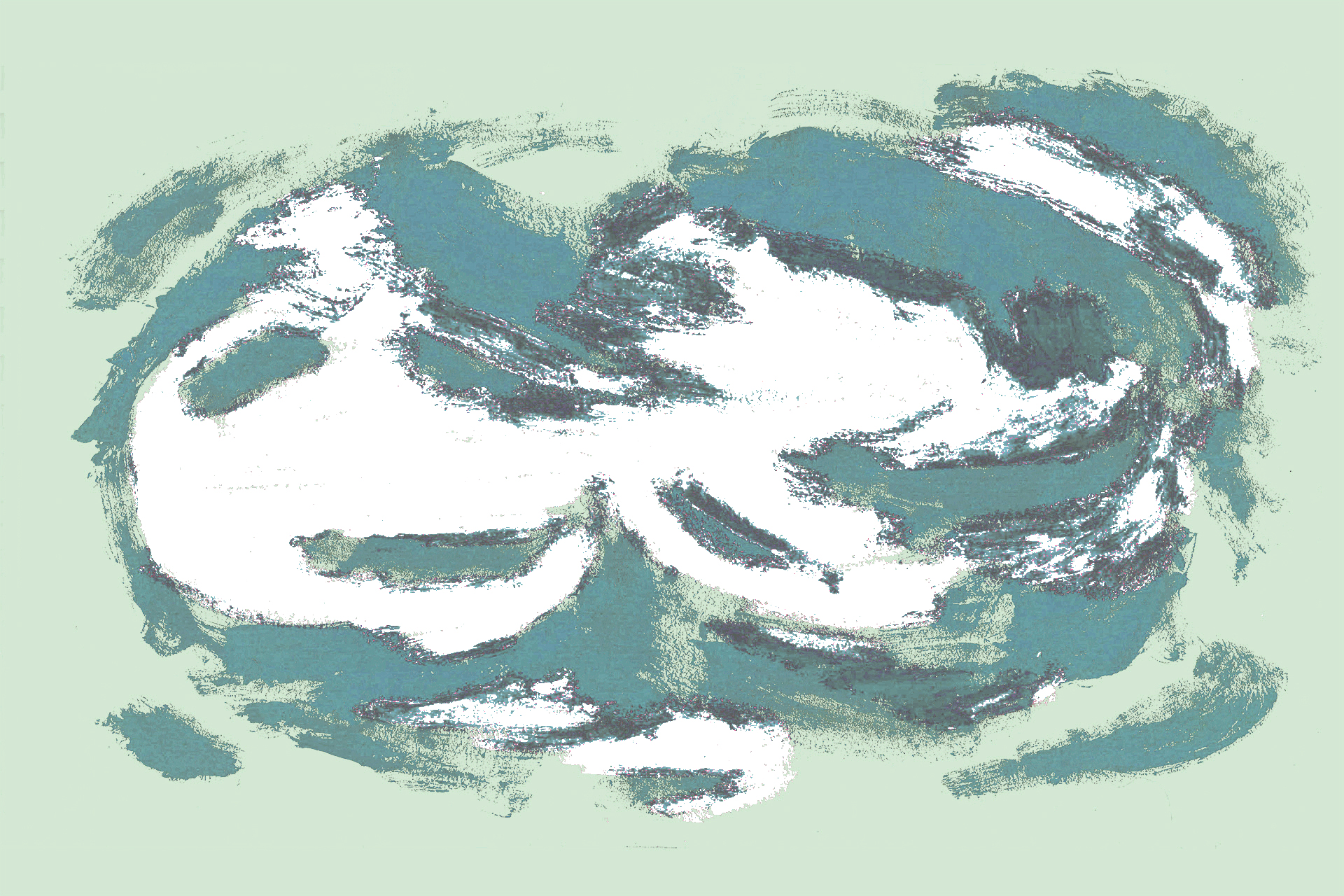
Luise Donschen
Nowhen: Wie hast du angefangen, dich für Film zu interessieren?
Luise Donschen: Ich habe relativ früh angefangen. Schon zu Schulzeiten habe ich zum Beispiel ein Praktikum gemacht beim offenen Kanal und ich habe dann auch im Abitur einen Film gemacht. Es gab immer ein Interesse dafür, mich mit dem Medium zu beschäftigen. Es hat aber noch länger gedauert, bis ich zum einen verstanden habe, was Film sein kann. Zum anderen auch, dass ich dem so viel Raum in meinem Leben gegeben habe, dass es zu meiner Arbeit geworden ist. Ich konnte mir noch lange Zeit viele andere Sachen vorstellen. Ich würde sogar sagen, über das Studium erst ist Film zu so etwas geworden, vielleicht sogar noch ein bisschen später. Es war nicht so, dass ich mit zehn Jahren schon wusste, dass ich Filmemacherin sein wollte und dann nur darauf hingearbeitet habe. Das kann ich wirklich nicht sagen. Film ist aus der Erfahrung des Filmemachens und aus der immer konkreter werdenden Art und Weise, wie ich Filme wirklich machen will, und der Verbindung zwischen Filmemachen, Filmeschauen, Kooperation und Leben zum Zentrum geworden. Es gab keinen entscheidenden Moment, es war wirklich ein Prozess. Als ich angefangen habe zu studieren und Filme zu machen, fand ich es wahnsinnig anstrengend. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe dann viel Zeit darauf verwendet herauszufinden, worauf ich beim Filmemachen Lust habe und danach den Produktionsprozess entwickelt.
N: Während des Studiums hast du auch einige Kurzfilme vor Casanovagen gemacht.
LD: Genau, während des Studiums habe ich einen Film mit einer Freundin zusammen gemacht. „Zwischen den Grenzen“ heißt er. Es geht um die DDR Vergangenheit und davon handelt auch mein nächster Film. Aber das war dokumentarisch, dieses Mal wird es ein Spielfilm. Dann kam mein Abschlussfilm „Macht, dass mir inne wird, was ich durch euch verloren habe“, auch dokumentarisch. Beide Filme haben einen Alexander Kluge-artigen essayistischen Ansatz.
N: Bei Casanovagen gibt es auch dokumentarische Sektionen, aber der hat eine ziemlich freie Form.
LD: Es gab ein ziemlich konkretes Drehbuch, gescriptet von dem, was ich von den Protagonisten wusste. Es ging ja viel um Rituale. Vor allem Elija, der Mönch und Undine, die Domina führen in ihrem Alltag immer wieder dieselben Inszenierungen auf. Aus denen habe ich bestimmte Szenen ausgewählt und sie neu zusammengebaut. Vor allem bei Undine habe ich die Session aus Bestandteilen zusammengebaut, die ich in unterschiedlichen Sessions von ihr beobachtet habe. Natürlich war mir schon bewusst, dass es Motive gibt, die wieder auftauchen werden und die ich auch nutzen kann, um den Film zusammen zu halten, aber auch einfach, weil sie mich interessieren oder weil sie vielleicht etwas mit meiner eigenen Lust zu tun haben, worum es ja geht. Ich ziehe das Gleiche an im Interview mit John Malkovich, wie Lumi in der Kneipenszene. Der orangene Rock. Da sind ja auch Motive oder Elemente, die immer wiederkommen.
Es war also schon vorher klar, dass ich Sachen in die einzelnen Stränge einbringe, die dazu führen, dass ich die Stränge verbinden kann, ohne dass ich sie in irgendwas reinzwingen muss. Weil das natürlich die große Sorge bei dem Film war, dass der nicht auseinanderfällt und gleichzeitig, dass ich keine der Geschichten zu sehr zurichten wollte. Dazu muss ich noch sagen, die Sachen sind halt auch über einen sehr langen Zeitraum gedreht. Die John Malkovich Szene war 2013. Das war das erste, was wir gedreht haben, das Interview. Fertig geworden ist der Film 2018. Also wahrscheinlich werden wir irgendwie so was wie 2017 das Letzte gedreht haben. Das heißt, ich kannte immer das Material, es war auch nie sehr viel. Wir haben ja nicht viel Geld gehabt und dazu auf 16 Millimeter gedreht. In der Zeit zwischen den Drehs konnte ich auch immer wieder Sachen umschreiben und in das schon Vorhandene reinarbeiten.
N: Die Sprache wird von Malkovich als Verführungsmittel gedacht. Sie ist ist auch etwas, was bei Casanova vorkommt, sowohl stilistisch als auch inhaltlich. Nach einiger Zeit, was hälst du von der Behandlung der Sprache in dem Film?
LD: Von der Sprache im Film ist es schon interessant, was die alles sein kann. Sie kann natürlich zuallererst mal Informationsvermittlung sein, was sie natürlich oft ist im Film. In Casanovagen haben wir Gespräche beispielsweise. Wir haben den Forscher natürlich, der sehr sachlich spricht. Das ist wahrscheinlich auch so eine Art Informationsvermittlung, die aber so kontextualisiert ist, dass sie auch hinterfragt wird in dieser scheinbaren Sachlichkeit. Filmisch ist Sprache vor allem dann interessant, wenn sie die Leerstellen aufzeigt, die trotz des größten Bemühens auf Verständigung bleiben. Beim Film ist Sprache nicht das erste, was mich interessiert, sondern sehr viel stärker der Körper und der Körper im Raum. Gleichzeitig denke ich viel darüber nach, an welchen Stellen die Sprache dann wirklich eine Rolle spielen soll im Film. Es ist schwierig mit Sprache im Film zu arbeiten, ihr den richtigen Stellenwert zu geben – in all ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen. Da bin ich noch auf einem Weg, würde ich sagen.
N: Im Film gibt es unzählige delikate Momente, wie zum Beispiel, als du und Elija sich im Museum umarmen. Es kommt in der Auflösung sehr unerwartet vor. War es so unerwartet wie es im Film vorkommt?
LD: Elija und ich haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und wir haben schon eine Beziehung zueinander entwickelt, die ich schon auch nochmal in ein konkretes Bild fassen wollte. Dann kam das Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff, die seine Lieblingsautorin ist und die ich auch in der Zeit viel gelesen habe. Es gab auch das Bedürfnis, aus diesem Raum des Klosters rauszukommen, ihn auch auf eine Art auch ohne seinen Habit zu zeigen. Er ist einfach ein komplett anderer Mensch ohne seine Kutte. Es war auch eine Art von Dank vielleicht, dass er mich da so reingelassen hat. Was davon jetzt dann wirklich sich vermittelt oder was da jetzt wirklich so drinsteckt, das kann ich nicht beurteilen, aber das war der Ausgangspunkt.
N: Wenn eine Person die Worte von Casanova vorliest, die vielleicht dem Gender von Casanova nicht entspricht, kommt das aus einer feministischen Haltung heraus?
LD: Ich glaube, dafür müsste ich mich erst mal als Feministin begreifen. Was ich in dieser Klarheit nicht tue. Natürlich erzähle ich als Frau und ich bin als Frau sozialisiert und sehe die Probleme als Frau in unserer Gesellschaft. Aber ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, als das zu betonen oder zum Framing meines Tuns zu machen. Das ist eher etwas, was im Untergrund mitläuft. Der Ausgangspunkt für den Text war, dass ich tatsächlich die Worte von Casanova auf so eine echt frappierende Art und Weise modern und männlich fand.
N: „Ganze Tage Zusammen“ setzt sich mit Repräsentationsfragen auseinander. Der Film tut dies durch seine Form, eine Form, die durch Nähe zum Thema kommt. Wie bist du auf Bielefeld, auf diesen Ort und auf diese Menschen gekommen?
LD: Das war tatsächlich eine persönliche Verbindung. Weil Bethel, ein Verein ein 150 jähriges Jubiläum vor ein paar Jahren hatten. Es gab jemanden, der dieses Jubiläum organisieren sollte. Ein ganzes Jahr sollten verschiedene Sachen stattfinden. Ich war eingeladen mich dort umzugucken, ob mir irgendwas einfällt, was ich da gerne machen würde. Sie haben mich herum geführt und haben mir verschiedenste Sachen gezeigt und unter anderem die Mamre-Patmos Schule. Es war so eindrücklich. Montags morgens findet da immer eine Andacht statt. Das ist ja eine kirchliche, also protestantische Einrichtung. Da werden alle Kinder und Schüler*innen aus der Schule in die in die Aula gebracht.
Egal, wie gut sie sich bewegen können oder in welcher Verfassung sie sind. Dann wird zusammen Musik gemacht und es werden die Projekte vorgestellt. Ich saß da drin. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich mit so verschiedenen Gefühlen auf so eine Weise so konfrontiert bin. Das war sehr, sehr emotional in verschiedenste Richtungen. Da hatte ich sofort Lust, Zeit zu verbringen und also einen Film zu machen. Ich habe dann immer gesagt, dass die Schule mein neues Kloster ist. Da habe ich so viel Zeit verbracht und habe Gefühle in mir entdeckt und in meiner Umgebung, die in meinem Leben vorher gar nicht so eine Rolle gespielt haben. In der Schule war das ähnlich.
Das war der Auslöser. Dann habe ich mich entschieden, etwas mit den Schülerinnen zu machen, die an diesem Übergang zwischen der Schule und dem Leben danach sind. Weil das der Knackpunkt war, was ich in Bethel an anderen Stellen gesehen habe – in den Werkstätten, in denen Menschen mit Behinderung für einen sehr geringen Lohn arbeiten. Die Schule war super, jede Schule sollte so sein wie diese Schule, aber sie ist halt nur deswegen so super, weil sie nicht wirklich aufs Leben vorbereitet. Also nicht auf unser kapitalistisch organisiertes, auf Mehrwert ausgerichtetes System. Sie können sich deswegen leisten, dort so toll Unterricht zu machen.
N: Ist es wichtig für dich also, zuerst die Orte zu kennen, in denen du einen Film drehen wirst?
LD: Es ist bestimmend, weil ich sonst gar nicht denken kann. Es gibt für alles, was ich schreibe, irgendeine Art von Vorbild. Wenn ich jetzt eine Wohnung beschreibe, dann kenne ich die ja vielleicht nicht unbedingt. Dann ist es meistens meine eigene Wohnung. Das kann sich dann schon auch mal ändern bei so was wie einer Wohnung. Aber in dem Fall, bei der Schule, brauchte ich sie. Es war ein Prozess. Ich habe einfach eine Zeit lang in solchen Klassen hospitiert und dann Paula, das Vorbild der Hauptfigur, kennengelernt. Sie hat diese Geschichte gehabt, dass sie im Grunde genommen von der Epilepsie „geheilt“ ist oder die zumindest nicht mehr nachweisbar ist und sie dann auf eine „bessere“ Schule gehen sollte.
Die Hauptdarstellerin ist dann nicht Paula geworden, sondern eine Laiendarstellerin aus Berlin. Sie ist die einzige, die nicht aus der Schule ist, weil es an einem bestimmten Punkt ein Problem war, diesen Film dort zu drehen. Es gab für die Lehrerschaft aufgrund des Endes zwei Probleme. Das eine war, dass man das Ende als Selbstmord lesen kann. Das andere war, dass das aus meiner Perspektive eine Selbstbehauptungsgeschichte eines Menschen mit einer Krankheit ist. Dass sich jemand über seine Krankheit begreift, darüber ein Selbstbewusstsein, eine Identität und eine Gemeinschaft begreift, ist für mich der Kern von der Geschichte. Das ist aus pädagogischer Sicht dort teilweise nicht so gut angekommen. Also dass ich kritisiere, dass man jemanden auf eine „bessere“ Schule schicken will, der sich eigentlich dort zu Hause fühlt, wo er ja früher mit Menschen mit Behinderung zusammen war. Das konnten die Lehrer*innen teilweise nicht nachvollziehen.
Ich musste, als das Drehbuch schon fertig war, noch mal von vorne anfangen. Mit den Schülerinnen, mit denen ich arbeiten wollte, konnte ich nicht mehr arbeiten, weil sich nur noch bestimmte Lehrerinnen bereit erklärt haben, mit uns zu arbeiten. Dann waren wir in anderen bestimmten Klassen, mit denen ich arbeiten konnte und habe das Buch noch mal umgeschrieben. Ich hatte noch vor im Film ein Gedicht lesen zu lassen, was ziemlich traurig war. Bei der Probe hat das die Schüler*innen sehr mitgenommen und sofort war eine große Unruhe in der Klasse. Ich verstand schon, dass die Lehrerinnen ihre Schülerinnen auch ein Stück weit schützen wollten. Deswegen war das die Bedingung, dass ich jemand von außen mitbringe. Miriam lebte in Berlin und ich habe sie auf der Straße gefunden.
N: Was ist für dich persönlich der Unterschied, den einen analog zu drehen und dann im Digitalen zu drehen?
LD: Der Ausgangspunkt für die Entscheidung für 16mm Material war, dass ich John Malkovich dazu bringen musste, mit uns an diesem Film zu arbeiten und ihm gesagt habe, dass ich ein Interview mit ihm mache, wenn er von der Bühne kommt und sich umzieht, was er sowieso machen muss. Und ich werde das filmen in einer Einstellung mit einer Rolle 16mm Material, die elf Minuten dauert. Dann ist es vorbei und er kann wieder gehen. Eigentlich hatte ich auch vor, diese Einstellung in einem Take zu lassen, was ich nicht gemacht habe. Das war sozusagen eine Setzung, auch um ihn dazu davon zu überzeugen. Ich hatte auch Lust, sehr begrenzt zu arbeiten.
Ich habe für den Film kein Geld gehabt. Mit anderen Worten: Ich habe mit den Leuten gearbeitet, die mir ihre Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Ich dachte mir, es wäre gut, wenn ich mit deren Zeit haushalten muss. Das kann ich am Besten, wenn ich sehr genau weiß, was ich filmen will. Während man beim Digitalen natürlich dazu verleitet ist, nochmal und nochmal alles mitzunehmen. Insofern war es für mich eine gute Einschränkung, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Es gab diese formale und diese ökonomische Begrenzung sozusagen. Bei „Ganze Tage Zusammen“ habe ich das einfach nicht gebraucht. Ich habe auch gewollt, dass kein Druck in der Situation entsteht, in der ich dort gearbeitet habe. Ich wollte nicht, dass es beim ersten oder zweiten Mal sitzen muss. Da gab es natürlich andere Beschränkungen. Es gab z.B. eine andere Art von Erschöpfung.
Man musste sensibel damit umgehen. Ich konnte auch nicht zehn Takes machen mit den Kindern, weil die es nicht schaffen. Also es muss irgendwie einen formalen Grund natürlich zuallererst geben. Ich brauche, so wie ich arbeite mit Helena an der Kamera, nie viele Takes. Wir bereiten immer sehr gut vor und wir wissen sehr genau, was wir wollen. Ich habe keine Angst mehr vor der Verführung des Digitalen, sozusagen in dem Sinne, dass man so viel produzieren kann.
N: Du arbeitest ja auch ganz viel mit natürlichem Licht..
LD: In der Schule kannte ich die Räume natürlich gut und habe versucht, die schönsten Räume zu finden. Aber das ist nicht leicht, weil das keine schöne Architektur dort ist und die Farben nicht unbedingt meine Lieblingsfarben sind. Das war auch eine Beschränkung, mit der man irgendwie umgehen musste. Wir haben innerhalb dessen, was es an Möglichkeiten gab, uns immer für das Schönste entschieden. Das war schon so, dass ich die Räume so gut kannte, dass ich wusste, was es für Vorteile oder was es das für Schönheiten gibt. Es gibt dann teilweise große Fensterfronten, dann kann man damit arbeiten, wenn es halt gerade Licht gibt an dem Tag. Aber wie gesagt, wenn jetzt keine Sonne geschienen hätte in dem Moment, wo André diesen Granatapfel zum Beispiel schält, wo das Licht sehr schön ist, dann wäre es nicht gegangen, wir hätten es nicht gebaut. Wir hätten es anders gemacht. Wenn die Sonne scheint, gibt es dort viele Fensterfronten und dann dreht man am Fenster. Es ist ein Reagieren auf das, was da ist.
N: Warst du in Japan, bevor du „Elle“ geschrieben hast?
LD: Ich hatte eine Residency für drei Monate in Kyoto und man muss sich mit einem Projekt bewerben. Ich habe mich beworben mit einem Filmprojekt, was im Botanischen Garten von Kyoto spielt, und zwar im europäischen Teil des Botanischen Gartens, weil ich ausschließen wollte, dass es zu viel gibt, was ich nicht kenne. Japan ist eine wahnsinnig starke und ausgearbeitete Kultur, von der ich nahezu nichts wusste. Nur aus den Filmen von Ozu. Ich wollte mich nicht so viel auseinandersetzen müssen in so einer kurzen Zeit. Dann habe ich eigentlich vorgehabt, einen Film zu machen, der viel dokumentarischer funktioniert und sich sozusagen mit der Frage des Menschen im kulturalisierten Naturraum beschäftigt und der Frage, wie ich alle Elemente, die daran beteiligt sind, Pflanzen, Werkzeuge, Menschen, Tiere, Erde, Luft, wie ich all das gleichberechtigt erzählen kann.
Das war eigentlich meine Idee, weil ich eben jetzt als ersten kompletten Spielfilm einen Film mache, wo eine Frau in einem Wald lebt. „Elle“ war wie eine Vorarbeit. Aber als ich da war, habe ich gemerkt, dass das nicht geht, weil ich gar nicht mit den Arbeitenden dort im Botanischen Garten kommunizieren kann und sie auch nicht mit mir. Es war zu kompliziert. Das heißt, ich musste was machen, wo ich Schauspieler mitbringen kann und an dem Ort etwas machen. Da saß ich trotzdem schon wochenlang immer auf dieser Bank, auf der Kaori, die Frau, in dem Film sitzt. Ich kannte den Ort schon sehr, ich kannte diese Statue. Ich wusste, dass morgens um neun das Licht am besten auf dieser Statue ist. Ich wusste, welche Elemente mich interessieren in diesem Bereich.
Und dann habe ich irgendwann eine Frau beobachtet, die eingeschlafen ist. In Japan ist es sehr normal, dass man im öffentlichen Raum schläft, der vielen Arbeit geschuldet. Man sieht einfach oft schlafende Menschen. Dann habe ich einmal eine Frau im No Theater gesehen, wo die Darsteller*innen eine Sprache sprechen, die die Japaner*innen selber nicht verstehen. Sehr minimalistisch, künstlich. Diese Frau schlief ständig ein, und wenn sie einschlief, war sie immer völlig in sich zusammengesackt. Dann ist sie aber wieder aufgewacht und hat wieder zugeguckt. Und von der Situation ausgehend habe ich dann diese Idee gehabt, dass es eben eine Frau geben könnte, die bei jemandem anders auf der Schulter einschläft und dadurch irgendwie eine Begegnung stattfindet, die deswegen möglich ist, weil die beiden sich nicht verstehen.
Der Mann im Film ist mein Partner, das Kind ist mein Kind und Kaori ist jemand, die mein Partner kennenlernte, als er einen Kintsugi-Kurs gemacht hat. Ich habe sie auf einem Fest kennengelernt. Sie hat eine gewisse Traurigkeit, die ich sehr gerne in diesem Film haben wollte, weil ich dann mittlerweile auf diese Geschichte kam mit dem Hund. So kam eins zum anderen. Kaori hatte Zeit, weil Kaori kein Geld verdient hat und das war auch praktisch, weil sie Zeit hatte, mit mir das zu proben und in so ganz kleinen Abschnitten zu drehen. Ich musste das alles sehr ökonomisch auch wieder machen, weil ich alles selber gemacht habe. Ich habe Ton, Kamera, alles gemacht und ich musste gucken, ob meine kleine Tochter, die in den japanischen Kindergarten ging, noch am Nachmittag nochmal eine Stunde Zeit und Lust hat, mit mir zu arbeiten. Es war alles sehr abgestimmt.
N: Mit wenigen Mitteln zu arbeiten kann auch sehr schwierig sein, hast du auch vor, Förderung zu bekommen?
LD: Ich mache jetzt den ersten Spielfilm mit Produktionsfirma und viel Geld. Also für einen Film eigentlich nicht viel Geld, aber für mich viel Geld. Aber für den Film ist es auch nötig. Den habe ich auch so geschrieben, dass ich dafür Geld brauche. Er spielt in einer anderen Zeit und ich will auch mit Schauspielern arbeiten. Aber bei „Elle“ war das anders. Bei dem Dreh wurde mir z.B. klar, dass es mir große Lust bereitet, selbst Kamera zu machen. Aber nur unter bestimmten Bedingungen.
Da gibt’s etwas grundsätzliches für mich: mehr zu haben, heißt nicht unbedingt mehr zu können. Teamgröße zum Beispiel. Für mich ist das mega entscheidend. Also mit wem kommunizierst du auf welche Art und Weise? Ich habe immer mit einem super kleinen Team gearbeitet, das bei „Ganzen Tage Zusammen“ war das größte, da hatte ich nicht nur Kamera und Ton, sondern auch noch eine Produktionsassistentin.
N: Worum geht es in einem neuen Film?
LD: Der heißt „Patty“ und da geht es um eine Frau, die 1990 in Bitterfeld in der DDR lebt. Dort arbeitet sie in den Filmwerken, also der Fabrik, in der Film in der DDR produziert wurde. Sie verliert ihre Arbeit und ihre Freundin in den Wirren der Wende. Sie geht in den Wald und lebt, wie wir dann erfahren, 30 Jahre in diesem Wald und kommt heute wieder raus also.
N: Du hast auch bei der HfbK auch unterrichtet. Wie hat dir die Arbeit da gefallen?
LD: Sieben Jahre war ich da. Es hat mir gut gefallen. Das Arbeiten mit den Studierenden hat mir sehr gut gefallen. Aber es gibt natürlich auch schwierige Sachen. Eine Institution ist immer schwierig. Für mich war es auch wichtig, wegzugehen. Ich habe schon unterrichtet, als ich noch studiert habe. Ich hatte schon einen Magister in Europäischer Ethnologie und Germanistik und konnte dann deswegen diesen Job schon machen, obwohl ich gerade meinen Abschlussfilm angefangen hatte. Es war sehr wichtig, da wegzukommen. Ich würde gerne irgendwann wieder in die Lehre gehen, aber es ist erstmal wichtig, dass ich Filme mache.
Ich habe aufgehört, weil ich tatsächlich aufhören musste. Man kann das immer nur für sechs Jahre machen. Ich habe dann ein Jahr Elternzeit gehabt, deswegen waren es dann sieben Jahre. Aber danach wird es nicht mehr verlängert. Ich finde es immer schwer zu sagen, ob ich es anders gemacht hätte, wenn die Umstände anders gewesen wären. Das kann ich dir nicht sagen, aber das hat mir ermöglicht, zwei Kinder auf die Welt zu bringen, was ich unter anderen Umständen vielleicht nicht so einfach gemacht hätte. Es war eine große Sicherheit für einen Zeitpunkt. Und es war für mich auch sehr wichtig, denn Angela Schanelec kam während meiner Zeit als Künstlerische Mitarbeiterin an die Hochschule. Das war schon für mich sehr wichtig, diese Zeit mit ihr dort noch zu erleben. Also ich sage immer, dass das eigentlich wie so ein wirkliches Studium für mich war, die Zeit dort als künstlerische Mitarbeiterin, weil ich vorher durch mein Doppelstudium auch gar nicht so viel Zeit an der Hochschule verbracht habe. Ich habe auch immer viele Sachen gleichzeitig gemacht.
N: Du hast es kurz erwähnt, aber wie funktioniert es für dich persönlich, Mutter zu sein und gleichzeitig Künstlerin?
LD: Es ist kein Problem. Ich habe aber auch bestimmte Entscheidungen getroffen. Meine Kinder sind sehr früh in die Krippe gegangen, zum Beispiel, mit wenigen Monaten. Ich habe also die Gesellschaft immer sehr in Anspruch genommen. Und ich habe eigentlich erst während der Corona-Zeit gemerkt, was es bedeutet, wenn man das nicht kann. In der Zeit konnten meine Kinder nicht zur Schule gehen. Das war wirklich schwierig. Es war der einzige Zeitpunkt, wo ich wirklich sagen würde, dass ich gelitten habe. Da ging es mir auch wirklich nicht gut. Ich konnte ja nicht arbeiten. Dann musste ich aber eben auch noch für meine Kinder da sein, auf eine Art und Weise, die ich einfach nicht kann. Ich kann meinen Kindern nur sehr begrenzt Schulsachen beibringen. Aber ansonsten würde ich sagen, bin ich sehr privilegiert aufgestellt. Ich habe eine sehr gut funktionierende Beziehung mit einem Mann, der auch frei arbeitet und der sehr für die Kinder da ist. Dann haben wir auch noch die Großeltern. Und wie ich schon sagte, nehmen wir die Gesellschaft voll in Anspruch.