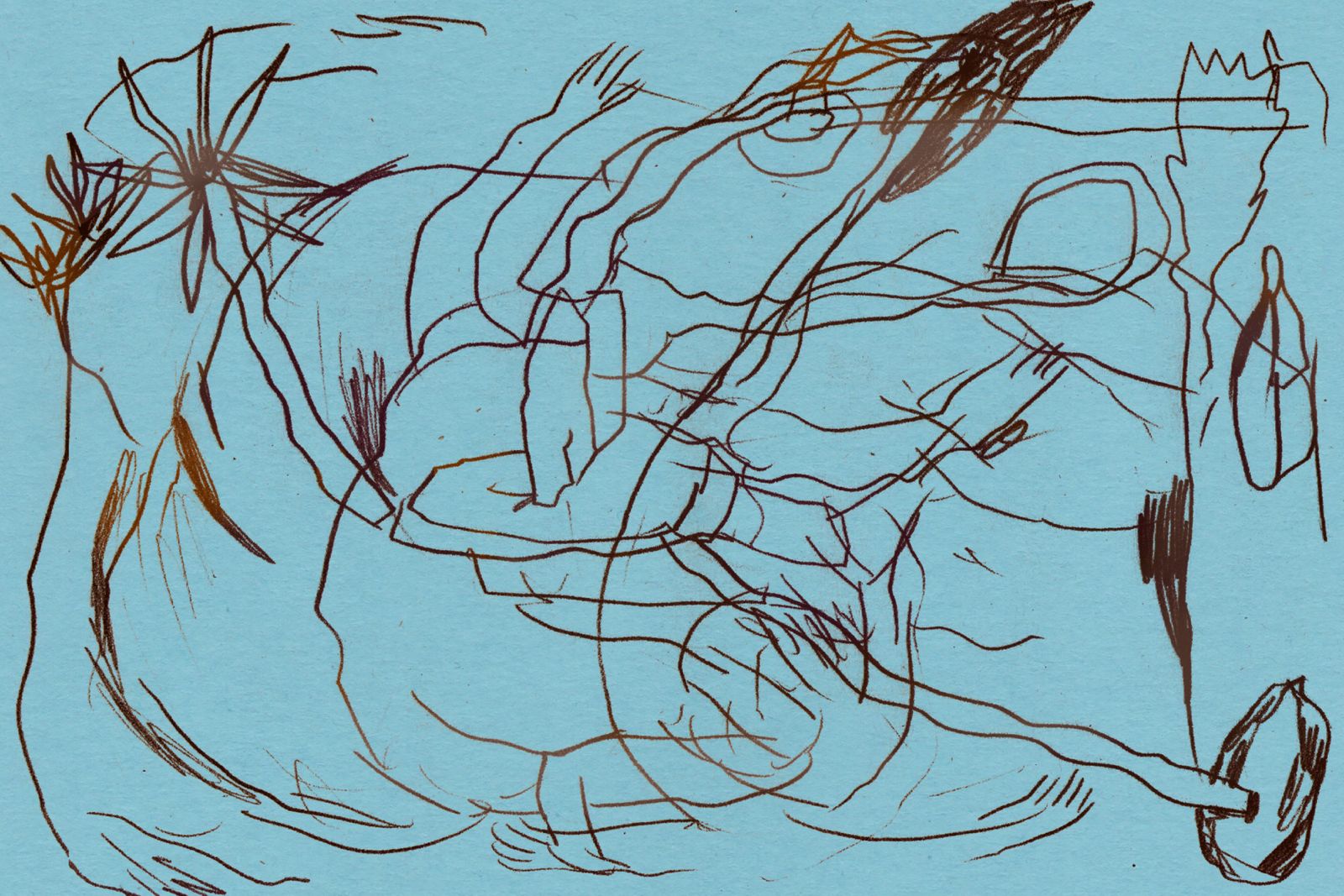
Sofia lebt, Barbara nicht. Über sechs Filme vom FID Marseille
In der drückenden Hochsommerhitze Marseilles wurden die Kinosäle zu einem klimatisierten Zufluchts-und Begegnungsort. Das diesjährige Motto des Festivals: Très cher.ères nous sommes ici ensemble ceci est un espace pour nous. Dieses inklusive Willkommensethos spiegelt sich in der Stimmung des gesamten Festivals wider, ein von Generationen und Bekanntheitsgrad unabhängiges kollegial-freundschaftliches Miteinander; als hätte sich die Sonne auf die Gemüter übertragen. Leider schienen aber die Erinnerung an den Tod von Nahel M. und die Proteste gegen die Polizeigewalt ausgeblendet zu werden, die noch wenige Tage zuvor in Marseille stattfanden. Mathilde Girard war hier eine Ausnahme, als sie ihre Rede beim Screening ihres Films Que quelque chose vienne dem Gedenken und der Solidarität widmete.
Die Auswahl der Filme im Wettbewerb war sehr divers und heterogen, allerdings war noch die dokumentarische Tradition des FID spürbar; wodurch monumentale poetische Dokumentarfilme neben mittellangen konzeptuellen oder experimentellen Kostüm-Filmen ihren Platz fanden. Zentrale Gedanken hinter dem Programming waren Multiperspektivität, Kollaboration als Leitmotiv, ein experimenteller Ansatz und soziologische Themen; wobei ein besonderes Augenmerk auf Agency betroffener Menschen gelegt wurde. Der Geschmack für ein divergentes, sehr persönliches Kino prägt die Poetik des FID Films. Auch Laure Prouvosts impulsiven, idiosynkratischen Videoarbeiten wurde neben alten Hasen wie Paul Vecchiali und Whit Stillman eine Retrospektive gewidmet.
O Marinheiro
Einige melancholisch-verwaschene Bilder von Betonpromenaden am Hafen, ein Leuchtturm im Hintergrund; eine einsame Glasflasche, die perspektivisch dieselbe Größe hat wie der weiter entfernte Turm. Einstellungen so bewegungslos wie Beton, so still wie Beton. Eine gleichmäßige Brandung. Eine Malerin mischt kontemplativ blaue Farbpaste in ihrem Atelier, knetet sie mit einem Spachtel lang und sorgsam. Sie schenkt sich bedächtig Wasser ein, schaut verträumt und versunken in ein Abseits; dann schließt sie die Augen. Auf eine Wand folgt ein schwarzer Screen für nahezu eine radikale Stunde lang, während im Voiceover Auszüge aus Ferdinand Pessoas “O Marinheiro” gelesen werden. Nur kurz unterbrochen durch ein schwarz-weiß Bild einer geschlossenen Tür und von den Klaviertönen von John Cages “Dream”, die immer wieder einsetzen und verebben, wie hinweggesogen.
In O Marinheiro, dem neuen Film von Sound-und Video-Künstler Yohei Yamakado, hallt eine gewisse Durasche Lethargie und ein konzeptioneller Strukturalismus nach. Besonders die fluktuierenden Tonmotive und deren konstantes An-und Abschwellen lassen an India Song denken. Die Farbe Schwarz hat nach Marguerite Duras dieselbe Macht wie das Meer1Duras, Le noir atlantique, in: Des femmes en mouvements, Nr. 57, Paris 1981, p. 30-31. . Sie ist weiter und tiefer als das Farbbild2Ebd.. In O Marinheiro bekommt sie eine zunehmend immersive Wirkung, ist nicht nur Abwesenheit von Bild, sondern vielmehr fließt sie mit den Worten dahin und trägt die Zuschauenden ganz tief in einen traumhaften Zustand. Ganz im Sinne der Duraschen Idee, dass die Farbe Schwarz keine statische, sondern eine Materie in Bewegung ist3Ebd.. Duras selbst hat in L’homme atlantique den schwarzen Bildschirm extensiv eingesetzt. Dieses Mittel wurde bei Yamakado in die Extreme geführt.
Der lange Mittelteil des Films ist wie ein Sehnsuchtsmonolog in einem tristen Raum; aber ein Raum, der die Freiheit der Gedanken nicht dimmen kann und diese durch seine Tiefe befeuert. Yamakado bricht und spielt mit Seherwartungen, denn Bilder sind im dritten Film des ehemaligen Le Fresnoy Studenten und Georges de Beauregard International Gewinner rar. An einer grauen, geschlossenen Tür inmitten der Schwärze prallt die Hoffnung der Zuschauenden nach Farbe ab. Während der FID Premiere gab es viele Walkouts. Die extensive, radikale Verwendung von Schwarz führt aber keinesfalls dazu, dass der Film seine feinsinnige Seele verliert, sie wird nur noch zarter und klarer.
Gleichzeitig ist das Schwarz eine Tragfläche der Sehnsucht, eine visuelle Wüste; jedes einzelne Sandkorn aus Nostalgie über den Verlust der Bilder und der visuellen Erscheinungen der Dinge, die in ihrer ständigen Vergänglichkeit nach dem Blick schon verloren sind. Das Betrachten einer schwarzen Fläche enthüllt den Blick an sich als sehnsüchtig. “Nur der Traum ist ewig und schön4 Pessoa, Le Marin, Éditions Corti, Paris 1989, S. 53. .” Die wenigen Farbbilder im Film sind in ihren Pastelltönen schon verblasst. O Marinheiro ist ein verträumter Film, der der Wahrheit des Sichtbaren gegenüber skeptisch ist. Im Dunkel in der Mitte des Films ist es, als würde die Zeit stehen bleiben.“Si je regarde le présent très attentivement, il me semble qu’il est déjà passé.5 Ebd., S. 25.” Die langsamen Bewegungen und statischen Einstellungen haben ihr eigenes, zeitloses Zeitgefühl, das der Schnelligkeit der Vergänglichkeit entgegenwirkt. Zeit wirkt gedehnt, der Moment langsamer, stabiler und doch luftiger wie Gedanken.
Die Gedanken des Textes selbst, die entblößt zur Geltung kommen und den gesamten Charakter des Films durchdringen, scheinen am Ende monoton und entleert. Da, wo bei Pessoa die Frage nach der Existenz und Nichtigkeit der Dinge steht, da wendet Yamakado im philosophischen Dialog eine nahezu absolute Nullführung der filmischen Elemente an. Gerade durch das Herunterbrechen und Dividieren der sonst so synästhetischen Seinsform des Kinos wird sein ephemeres, filigranes Skelett sichtbar; Bild, Ton und Wort stehen nackt und schön. O Marinheiro ist auch Reflexion über die Natur des Kinos und seine Variablen, die auf konzeptuelle Weise ausgenüchtert werden, wodurch der Film zu seiner poetischen Klarheit kommt.
Dies lässt einen reinigenden Frieden zurück, der über der latenten Melancholie der Erkenntnis des ständig Vergehenden liegt. Ein Gefühl, das sich einstellt, wenn die Augen auf dem Meer weilen. Yamakados Film ist in vielerlei Hinsicht strukturell wie das Meer, beide sind aus einem Kommen und Gehen von Sound und Bild gemacht. Wellen. Wobei die visuelle Ebbe, das Abhandensein von Bild mit einer konstanten, langen, nicht enden wollenden Flut an Worten kombiniert wird. O Marinheiro ist wie ein Schließen der Augen – mit tiefer Kontemplation und Traum in seiner dunklen Mitte; dann öffnen wir sie wieder und betrachten die wenigen Bilder, versunkener als zuvor.
Geology of Separation
In einem alten Hostel in Italien, das zu einer Erstaufnahmeeinrichtung umfunktioniert wurde, werden geflüchtete Männer in ihrem Alltag begleitet, der durch die ständige Überwachung der Sozialarbeitenden gefängnisartige Züge trägt und von Warten und Stillstand geprägt ist. Geology of Separation ist ein Dokument der Hürden in Asylantragsprozessen und der intrinsischen Xenophobie der europäischen Einwanderungspolitik. Sozialarbeitende verhalten sich wie chauvinistische Bewährungshelfer; ein Obstplantagenbesitzer nutzt die Asylanten als kostenlose Arbeitskräfte aus. Die Kamera ist dabei stille Beobachterin von einem unreflektierten Wiederholen kolonialer Ausbeutungsstrukturen und deckt darin erschreckende Analogien zur Sklaverei auf.
Auch die menschenunwürdige Situation der Ungewissheit und des Wartens wird in treffend gewählten dokumentarischen Sequenzen analysiert. Manchmal verliert diese politische Präzision durch die teils arbiträre Länge der Einstellungen an Kontur; aus der erkenntnisbringenden Assoziation wird teils Orientierungslosigkeit. Der Kern dieses Problems liegt aber primär im Transzendieren der Migrationsthematik in eine persönliche Poesie und Philosophie der Filmemacher*innen. Wertvolle Beobachtungen werden etwas zu sehr abstrahiert, statt sich ganz den Geschichten und Gesichtern der Asylanten zu widmen. Manchmal klingen die Gedichte von Abderahmane, einem Protagonisten, im Voice Over; allerdings hätte ich mir angesichts der monumentalen Länge des Films gewünscht, er wäre vorwiegend durch seine (lyrische) Stimme erfüllt. Stattdessen werden die metaphorischen Bilder durch zwei Elegien weitergeführt, die die Regisseurin geschrieben hat. Diese kontemplativen Sequenzen heben das Problematisieren politischer Missstände in einen nahezu expressionistischen Weltschmerz-Pathos – das Motiv der Pangäa, des letzten Superkontinents vor der Teilung der Kontinentalplatten, wird klanglich über Luftaufnahmen der Alpen gelegt; letztere als unüberwindbare Barriere zwischen Mittelmeer und Europa. Diese Romantisierung der Grenze suggeriert ungewollt einen gewissen Fatalismus. Die soziologische Beobachtungsgabe wird schwach gezeichnet, indem die vorherrschenden Zustände als der Welt zu eigen dargestellt werden, statt als veränderbar. Allerdings hat die Montage an sich eine tektonisch verbindende Qualität. Formal ist er ein exzessiv grenzenloser Film, eine Géologie de l’Adjonction.
Trotzdem versandet das politisch akzentuierte Vorhaben um einige Körnchen in einem Weltschmerz-Poesieteppich, der leider nur teilweise aus der Lyrik der Betroffenen gewebt ist. Abderahmanes Nostalgie hätte anhand seiner Erfahrungswerte mehr Gewicht. La force diagonale, ein anderer Film, der in der gleichen Sektion lief, arbeitet zum Beispiel mit einem ähnlichen monumentalen Eklektizismus in der experimentellen dokumentarischen Form. Hier ist der Assoziationsteppich zwar loser gehäkelt, wobei sich im Strickwerk mehr Raum für Individuen und deren Traumata findet; trotz abstraktem Kern. Eine politische Analyse schließt ein Abstrahieren nicht kategorisch aus. Allerdings ist die wichtigere Frage jene, nach der Größe des Raums, der der Stimme der Betroffenen zur Verfügung gestellt wird.
Dans le silence et dans le bruit
Dans le silence et dans le bruit widmet sich dem ruhigen Klinikalltag von Patient*innen der offenen psychiatrischen Klinik La Chesnaie. Der Film wurde in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Menschen gedreht, die dort in Therapie waren. Auch der Entstehungsprozess ist mit dem kommunitären Gedanken durchdrungen, der im Zentrum des Films steht – die Regie ist ein gemeinsames Projekt von Clément Roussier und Hadrien Mossaz.
Roussier und Mossaz haben eine erstaunliche Sensibilität für das Innere der Protagonist*innen; diese können frei atmen und scheinen gleichzeitig im sanften Charakter der langen, statischen Einstellungen geborgen zu sein. Der Kameraausschnitt wird selbst zu einem schützenden Raum. Diese Momente strahlen eine Ruhe aus, wie sie sich am Nachmittag im Blätterschatten eines Gartens finden lässt. Die narrativ-dokumentarischen Szenen sind in ihrer dezenten Poesie sehr gelungen, verlieren aber ihren Gestus durch die multiplen experimentellen Sequenzen, die meistens schön, teilweise stilistisch etwas fragwürdig sind. Die betrunken schwankende Kamera stupst den Film tollpatschig aus dem Gleichgewicht und seiner Ruhe. Darüber lässt sich aber leicht hinwegsehen, denn ein im Kollektiv entstandenes Kunstwerk kann nur disparat sein. Den Protagonist*innen wird agency verliehen, indem von ihnen selbst gefilmte Videos eingebunden wurden. Die teils holprigen und sehr poetischen Aufnahmen aus der Hand der Patient*innen verleihen Multiperspektivität, Intimität und die Möglichkeit, sich selbst aufs Individuellste zu portraitieren.
Der Augenausdruck von Clémence, eine Protagonistin, erfüllt den gesamten filmischen Raum mit Melancholie und Tiefe. Gleichzeitig bewahrt Dans le silence et dans le bruit eine hoffnungsvolle Sicht auf psychische Erkrankungen, die schon fast am Utopischen lehnt. In einem Miteinander findet sich Trost, wenn auch nur temporär und ortsbezogen – es kommt zu zarten Begegnungen Leidender in einer insularen Stille und Zeitlosigkeit. Clémence läuft nach ihrer Entlassung aus der Klinik an der Küste entlang, verlorenen Blickes; dann verliert sie die Kamera aus den Augen. Sie hat den Halt der schützenden Umgebung der Klinik verlassen und ist nun zurück in einem bedrohlichen Außen; wieder im Lärm. Sie läuft in Richtung des Meeres, in die Ungewissheit.
Der Film ist ohne Zweifel durch eine liebevolle Blickpolitik geprägt, die keinesfalls eine Hierarchische ist. Die Sequenzen, in denen Clémence angeschaut wird, sind proportional aber noch dominanter als jene, in denen sie Autorschaft besitzt und selbst filmt oder spricht. Dabei bleibt die Frage, inwiefern ihre Perspektive wirklich zum Tragen kommt oder sie vornehmlich Projektionsfläche der (männlichen) Sehnsucht bleibt und somit das chorische Gleichgewicht des Films negiert wird.
Die Übergänge von Innen und Außen werden durch die Figur Clémence getragen, aber auch gewissermaßen an ihr ausgetragen. Auf wackelnde Handyaufnahmen, die Filmmaterial von nächtlichen Einbrüchen gleichen, folgen ihre eigenen Aufnahmen beim Aufwachen und Einschlafen im Bett. Diese Gegenüberstellung fühlt sich durch die Chronologie der Montage wie ein Eingriff in ihre Privatsphäre an. Zudem schließt sich eine Szene an, in der ihr ein Freund aus der Klinik ein Kartenspiel erklärt mit den Worten “wir haben drei Diebe, die in das Haus eindringen”, während sie ganz benommen dasitzt. Ihre Entlassung steht bevor. Es geht um die Dichotomie von Innen und Außen, Klinik und Welt; aber auch um ein Eingreifen in ihren intimen Raum.
Im philosophischen Sinne ist sie die personifizierte Einsamkeit, die Traurigkeit, die sich vom Kollektiv abspaltet, in den Film und aus ihm hinaus trägt. Sicher ist, dass der Film wunderschöne Momente voller Zärtlichkeit aufspürt, die Hoffnung geben; in ihrer harmonischen Stimmung fast zu utopisch. Doch manchmal ist es heilsam, Utopien zu leben; wenn auch nur für eine kurze Dauer im Kinosaal. Eine Stunde drastische Stille und Langsamkeit als stringenter Gegenentwurf zur Gewalt der kapitalistischen Erfolgsmoral – ‘Werte, die den Sensibelsten unter uns keine Chance lassen’; so Clémence zu Beginn des Films.
Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin
Auch dieser Film von Martha Mechow, der im Debütfilm Wettbewerb lief, beruht auf einer Maxime der Kollaboration; hier vielleicht noch radikaler als in Dans le silence et dans le bruit. Für Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin gab es vorab kein Drehbuch, das ist erst im Laufe der Dreharbeiten durch mündliches Nacherzählen einer Ausgangsgeschichte entstanden. Erst, als diese durch alle Münder des Filmteams gegangen war, schrieb die Regisseurin sie auf. Auch der Schnitt und das Schreiben vom Skript verzahnen sich bei Mechow unmittelbar – nach dem Drehen kam das Editing, dann hat sie einen Text zur gerade geschnittenen Sequenz geschrieben, was als Inspiration für die nächsten Dreharbeiten diente.
Eine junge Mutter, Flippa, sucht ihre Halbschwester Furia, die mit 16 die Familie verlassen hatte; wie auch Gründe für das Verschwinden ihrer Mutter. Sie findet Furia (prägnantes Spiel von Ann Göbel) in Italien in einem Mutter-Kind-Kurort, in Gesellschaft einer Gruppe von Müttern, die die Einrichtung besetzt haben – sie wenden ein feministisches Gegenprogramm an: einen für die patriarchale Gesellschaft maximal dysfunktionalen Lebensstil zu etablieren, um nicht wieder möglichst schnell in die alltägliche Ausbeutung zurückzukehren. Furia ist mit der Leiterin der Einrichtung liiert, Rumpel, eine wesentlich ältere Frau mit stechendem Blick (fulminant-selbstironisch gespielt von Inga Busch).
Im Zentrum des Films steht die Mutterschaft als kleinster patriarchal-kapitalistischer Nenner, in dem die Rollenverteilung von Mann und Frau als unstreitbar angesehen wird. Der Film beginnt mit einer Mutter, die zwischen Lehne und Sitz des Sofas verschwindet, als ihr Kind sie ruft. Diese Ablehnung der perfekten Ausführung der Mutterattribute-und Tätigkeiten erinnert vage an Angela Schanelecs Filme, die in diesem Jahr Präsidentin der Internationalen Jury war und an der HFBK in Hamburg lehrt, an der Mechow Film studierte. Allerdings geht diese subtile Problematisierung hier in eine exzessive, laute Rebellion über; die Charaktere befreien sich von dieser Last und versinken nicht in einer lethargischen Erschöpfung. Einmal wird vor den Augen eines konservativen Vaters mit Josefsbart bei einer Madonnenfigur das Kind vom Körper der Maria abgeschnitten, mit einer Motorsäge. Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin ist insofern camp, als dass nach Susan Sontag die Liebe zur Künstlichkeit und Übertreibung6Susan Sontag, Notes on ‘Camp’, Penguin, London 2018, S. 1. ausgeprägt ist. “It is the farthest extension […] of the metaphor of life as theater.7 Ebd., S. 9. ” Das liegt vor allem im brechtschen, traktatartigen Sprechen und in der Verwendung des Soundtracks. Gleichzeitig ist dieses ausgestellte Artifizielle auch mit der Nähe zum realen Leben eng verknüpft – gecastet wurde durch Aushänge in Kitas und Schulen; die krisselige Haptik der 80er-Videorekorder schafft eine authentische Ästhetik.
Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin ist stilistisch so unabhängig wie kein anderer FID-Film, der im internationalen Wettbewerb vertreten war. Ein verspielter, freudiger Ausbruch aus den Engen des Normativen, aus den Engen des Stils. Kantig, poppig, wild, bewusst trashy, laut und camp, wunderbar seltsam, skurril, selbstironisch, impulsiv und intuitiv mit einem elektrisierenden Rhythmus. Ein Film, der lärmt und tanzt und dabei doch – oder gerade weil – so gut und so ernst ist. Die Charaktere halten feministische Monologe, die oft sehr stark, oft auch in ihren Feststellungen zur Existenz von Sexismus und Patriarchat unbedarft und harmlos sind. Aber dann ist es plötzlich wieder sehr tief; am Ende spricht ein kleiner Junge über die kindlichen Ängste des Verlassenwerdens und dass er diese nicht habe, als Flippa gerade dabei ist, ihn zurückzulassen. Die brutale Tat wird zur feministischen, denn sie wird aus dem Bewusstsein heraus getroffen, dass es gerade die Frau ist, die durch ihre Muttergefühle dazu nicht fähig sein sollte.
Um den jugendlich-naiven Charakter des Films besser einordnen zu können, lässt er sich wie folgt zitieren: “Was Flippa im Herzen wohnt, sitzt nicht allein auf ihrer Zunge.” Obwohl auch das Skript des Voice Overs hohe literarische Qualitäten aufweist, ist die Wichtigkeit des Performativen entscheidend. Mechow versteht sich zunächst als Schriftstellerin und ist Legastenikerin, weshalb die Performanz von Literatur für sie wichtig ist. Was diesem Film im Herzen wohnt, ist ein unbändiger Aufbruchswille, der eine vielversprechende neue Stimme im queer-feministischen deutschen Kino ankündigt. Ein sprühendes Debüt, so unmittelbar-künstlich wie Theater und so körperlich-theoretisch wie feministische Performance Kunst. Erstaunlich, wie angstlos sich Mechow in stilistischen Experimenten bewegt, ohne Scheu vor formaler Heterogenität; eine spielerische Selbstsicherheit, die Agnès Vardas späte Werkphase prägt.
Die Herstory ist eine noch junge Geschichtsschreibung; das heißt Grundlegendes ist noch nicht überflüssig geworden – auch eine queerfeministische Lesart des Verständnisses der Frau in der Bibel ist es nicht. Es ist eine Naivität, die die Bibelmoral und somit Werte, die unserer Gesellschaft zugrunde liegen, als naiv entlarven. Der Film ist also auch ein Beweis dafür, dass ein camper Film – gegenüber Sontag – nicht entweder komplett naiv oder sich darüber vollständig bewusst sein muss. Mechow gleitet von einem ins andere, auf inhaltlich-symbolischer Ebene auch zwischen sesshafter Unschuld und dynamischer Freiheit. Flippa als erster Pol, während Furia und Rumpel (die immer in Bewegung sind) als lesbisches Paar diese ‘korrumpieren’ (siehe den englischen Titel Losing Faith). “[…] Camp discloses innocence, but also, when it can, corrupts it.8Ebd., S. 15.” Rumpel, die Leiterin der alternativen Kurgemeinschaft, die Hexen, wie sie sich selbst nennen, liefert das Metakommentar zum Film, der sich besonders hier als Herstory-Manifest präsentiert: “Es gibt keinen Plan, es gibt Möglichkeiten und die gilt es auszuprobieren. Der Ausschluss der Möglichkeiten schreibt die Geschichte.” In diesem Kontext lässt sich der Verlauf der Erzählung und die überbordend-übermütige Form des Films verstehen, denn die Auslassungen der Geschichtsschreibung müssen nachgeholt werden. “Schließlich sind Dinge, die nur einen Zustand kennen, auch nicht wahr.9Zitat aus dem Film.” Oder, um es in Oscar Wildes Worte zu packen: “The truth is rarely pure and never simple.10 Wilde, The Importance of Being Earnest, Dover Thrift Editions, 2020, S. 6.”
Ein Stück gelebte Literatur.
An Evening Song
Das mondäne Schriftsteller-Ehepaar Richard und Barbara (Hannah Gross) ‘nehmen’ sich ein Dienstmädchen aus dem nächsten Dorf, um ihr bürgerliches Landhaus im mittleren Westen in Stand zu halten. Richard, ein gegelter, sympathischer junger Mann mit Brille, schreibt Horrorerzählungen. Barbara, eine unnahbare Lyrikerin mit tiefblauen Augen und dunkler Stimme, hat seit Jahren eine Schreibblockade und streunt stattdessen in prächtigen Kleidern und Zeitlupe durch umliegende Wälder. Dort streunt auch ein haariges Mischwesen zwischen Mann und Tier herum. Barbara und Richard entwickeln beide eine Faszination für die stille, gottesfürchtige Martha mit dem lieblichen, aber von Narben übersäten Gesicht.
Diesem ästhetisch ansprechenden Film kann die Sontagsche Wertung zugesprochen werden, dass Camp auch bedeuten kann, den Stil auf Kosten des Inhalts zu betonen. Tatsächlich sind die Erzählstränge zu lose aneinandergewebt und plätschern dahin; wobei die Bilder zu seichten Impressionen und schmückenden Illustrationen werden. “To emphasize style is to slight content. […] For Camp art is often decorative art, emphasizing texture, sensuous surface and style at the expense of content.11Susan Sontag, Notes on ‘Camp’, 2018, S. 4-6.” Die Ästhetik von Graham Swons neuem Film lässt sich tatsächlich als ‘sinnliche Oberfläche’ beschreiben, und ist durch die Textur analoger Körnung und ihrer Romantisierung geprägt.
An Evening Song ist technisch sehr innovativ und erzeugt visuell eine seltene Traumwelt, in der alle Bilder fluide ineinander verschmelzen. Die enorme Innovationsleistung besteht darin, dass die Reflektionen auf dem Spiegel einer analogen Großformatkamera mit einer Digitalkamera abgefilmt wurde; wodurch das besondere, verwaschene Bild entstand. Diese Lust an Formspielen führt allerdings zu einer stilistischen Überladung, Überblendungen werden beispielsweise viel zu exzessiv eingesetzt; wobei der Film nicht nur in diesem Sinne zu verträumt ist.
Auf der Ebene des Plots bleibt er ein reines Fetisch des Regisseurs und zwar Ausdruck seiner Leidenschaft für das Melodrama und dessen verstaubter Strukturen. Die Liste von Filmen mit lesbischen Storylines von cis-(hetero)-männlichen Regisseuren ist lang. Im Vergleich zu La vie d’Adèle (2013) von Abdellatif Kechiche, der durch die langen und expliziten Sexszenen ins Pornographische und die Übersexualisierung gleitet, verpufft das Sexuelle bei Swon in eine Blümchenwolke der Theorie und Idealisierung von sapphischem Begehren. An evening Song teilt mehr die Verschleierung weiblicher Sexualität aus Todd Haynes Carol (2015), wobei hier am Ende die lesbische Liebe als Mögliche dargestellt wird. In der Obsession für die erotische Kraft von Stoff und Kostüm erinnert er mehr noch an Peter Stricklands Melodrama The Duke of Burgundy (2014). Dieser hat Freude an der Überästhetisierung weiblicher Erotik, wobei das geteilte Klischee der Liebe zwischen einer sexuell dominanten, älteren Frau und einer passiven, jüngeren Frau durchaus aufgebrochen wird. An Evening Song bleibt in dieser fetischistischen Verträumtheit stecken.
Aber viel mehr noch wird ein Motiv reproduziert, das besonders stark in Claude Chabrols Les Biches (1968) vertreten ist – der Mythos der lesbischen Liebe als narzisstische Liebe. Sapphische Anziehung wird dabei auf den Neid und die Bewunderung einer erfahrenen, selbstsicheren Frau und ihrer Position durch eine jüngere Frau reduziert und so begründet. In An Evening Song sind die Frauenfiguren ähnlich konzipiert – eine gebildete Femme fatale, die stolz, unabhängig und sich ihrer Reize bewusst ist; ein verträumtes, verschüchtertes Hausmädchen ohne Selbstbewusstsein und sexuelle Erfahrung. Die Reproduktion eines solchen Klischees ist mehr als nur nicht zeitgemäß; auch wenn der Effekt bei Swon nicht bewusst herbeigeführt wurde. Homophobie ist immer noch omnipräsent; queere Repräsentation in Arthouse Filmen zwar im Kommen, wird aber oft noch von den alten Geistern des Vorurteils heimgesucht. Auch bei Swon hat es sich durch die Hintertür des Melodramas eingeschlichen.
In An Evening Song bleibt lesbisches Begehren in der Theorie, auf der Ebene eines einmaligen Blümchen-Kusses in einer Wildblumenwiese, während eine der Charaktere von ihrem Sextraum mit einem imaginierten Ehemann erzählt. Dieses Theoretisieren steht auch zwischen den Zeilen im Skript, als Martha von ihrem Traum erzählt: “a drop rolls of my feathers, it doesn’t even touch my skin.” Im Moment, in dem sie den Ehemann erwähnt, wird Barbara durch eine Zweifachbelichtung gedoppelt. Auch beim Kuss legen sich zwei transparente Bildebenen verschoben übereinander, was die Realität dessen verringert. Als dieser vorüber ist, öffnet Martha ungläubig die Augen, als wäre alles nur ein Traum gewesen. Die Bildebene, die währenddessen dominant war, verschwindet danach wieder. Die Ménage à trois zwischen dem Schriftsteller-Ehepaar Barbara und Richard und ihrer Haushaltshilfe Martha verliert schnell sein gleichberechtigtes Gleichgewicht, indem sich der heterosexuelle Pol realisiert. Das passiert, während Barbara in einer regnerischen Nacht in einem Schwall von nebulöser Undeutlichkeit zwischen Selbstmord und Ausbrechen aus den bürgerlichen Banden der Ehe verschwindet.
Dieser Akt mag rebellisch klingen, ist aber im Gefüge des Filmvokabulars ein tradiertes Plot-Element. Die meinungsstarke Frau räumt der zarten, zaghaften den Platz; mehr noch vergeistigt sie sich in eine Nicht-Präsenz. Als Barbara am Rand eines Sees steht, spricht ihre Stimme im Voice Over über physische Auflösung: “Making the transition from the material to the immaterial is a privilege, an honour; the act of dissolution isn’t difficult […]”. Während sie das spricht, geht die Szene darin über, dass Martha eines ihrer teuren Kleider anprobiert und darin masturbiert. Zumindest beginnt sie, bis sie von Richard unterbrochen wird und sie letztlich miteinander schlafen. Ihr Verlangen nach Barbara bleibt ungreifbar, vielmehr noch materialisiert es sich darin, dass sie ihren physischen Platz einnimmt. Die Sexszene zwischen Martha und Richard wird mit Bildern gegengeschnitten, in denen Barbara sich vom Regen durchnässt auf nächtlichem Waldboden räkelt, Baumrinde küsst, über den Boden kriecht und sich mit Erde beschmiert. Allerdings geht es hier mehr um Auflösung körperlicher Grenzen, als um eine Symbolik von Homoerotitk. Die lesbische Storyline wird hier als juicy Accessoire des Films funktionalisiert, um das Melodrama attraktiver und ‘moderner’ zu machen. Das ist auch eine Form der patriarchalen Einhegung lesbischer Liebe, wenn auch nur in fiktive heterosexuelle Narrationsrahmen.
Wenn diese Liebe auch letztlich im Voice-Over als die einzig wahre angedeutet wird, so wird ihr aber visuell keine Substanz verliehen. Natürlich ist es das Grundprinzip des Films, Strukturen alter Filmtraditionen mit neuen Visualitäten zu verbinden, allerdings hätte Graham Swon durchaus mutiger sein können in der Modernisierung des melodramatischen Plots und insbesondere sensibler im Umgang mit der Genealogie lesbischer Repräsentation im Film. Unbedarft hat sich Swon auf einen Berg aus Altlasten gesetzt. Und da sitzt er nun, voller Bewunderung für diesen romantischen Rost.
Sofia foi
Sofia klettert über einen Zaun, als letztes verschwindet ihre Hand aus dem Bild; sie lässt das Gitter los. Wassergeräusche. Komplette Finsternis. Sie kommt langsam auf die Kamera zu, unscharf, dann im Off, dann ist ihr Gesicht ganz groß. Ernst fixiert sie etwas Unsichtbares, ihre Augen weiten sich leicht. Sie dreht sich um und verschwindet wieder in der Dunkelheit.
Auch in Sofia foi, einem Film von Pedro Geraldo, der den Debütfilmpreis in Marseille gewann, hat die aus der Mode gekommene Überblendung als stilistisches Mittel Konjunktur. Hier allerdings weniger inflationär als in An Evening Song und dafür punktueller. Die Verträumtheit, die auch hier entsteht, ist eine politisch relevante Verträumtheit, die geerdeter ist und so tiefer greift.
Die 16-jährige Sofia (tief, intuitiv und feinfühlig-facettiert gespielt von Sofia Tomic) musste ihre Familie verlassen und wird obdachlos, als sie auch bei einem Freund nicht mehr bleiben kann. Sie verbringt Tag und Nacht am Campus ihrer Uni in Sao Paulo. Tagsüber sticht sie Tattoos, abends schläft sie im Parkhaus. Sie verlässt das triste Unigelände nie. Hinter einem Zaun liegt ein See, versteckt hinter grünem Dickicht; an diesen Ort kehrt sie immer wieder zurück. In ihren Träumen und im Wachen. Schmerzliche und heilsame Erinnerungen an eine verlorene Liebe sind an ihn gebunden. Dort hat sie auch ihren Hund ausgesetzt; wenn Gefahr droht kann man ihn noch treu aus räumlicher und zeitlicher Ferne winseln hören.
Geraldo, der auch selbst gefilmt hat, schafft durch das Seitenverhältnis 4:3 in Kombination mit den extremen Close Ups eine hohe Intimität mit der Protagonistin. Doch Sofia ist auch immer am Vorübergehen, im Begriff in und aus dem Bild heraus zu oszillieren, wie ein ephemeres Phantom; so auch der Titel, Sofia war, der bereits am Anfang eingeblendet wird. Sie ist schon vergangen und doch so präsent; wie der Spätsommer im Übergang zum Herbst noch einmal aufblüht. Oft beginnt eine Einstellung leer, zeigt das Nichts, wird von der Protagonistin gefüllt, und kehrt wieder in diesen Zustand zurück. Dieses Schanelecsche Nachhallen einer Bewegung und die zurückbleibende, elektrisierte Leere, die niemals Leere ist, beherrscht Geraldo eindrücklich. Gleichzeitig ist der atmosphärische filmische Raum bei Geraldo nie ganz trostlos. Denn Sofia lebt in einer sanften, hoffnungsspendenden Utopie schöner Bilder, in der ihr ein Leben und ein Herz geschenkt wird; sogar am Ende hört dieses nicht auf zu schlagen. Herzen sind in Rinde und als Tattoo in ihre Haut geritzt. Darin liegt sowohl Bitterkeit über die Härte des Lebens, die in sich wahrer nicht sein könnte, als auch, trotz Melancholie, eine lebensbejahende Leichtigkeit.
Das Spiel und die Körpersprache von Sofia Tomic, die Sofia verkörpert, haben eine hohe choreographische Kraft; jede Bewegung scheint natürlich und symbolisch zugleich. Die Einstellungen an sich strahlen eine Ruhe aus, während Tomic frei fluktuiert, aber immer bestimmt und immer subtil. In den extrem hohen Kamerawinkeln und Close Ups erinnert die Ästhetik an Reinhold Vorschneiders Kameraarbeit in Plätze in Städten. Die Protagonistinnen haben eine ähnliche Position in der Bildkomposition; sehr nah, der Nacken oft von hinten oder seitlich gefilmt. Allerdings befindet sich der Zuschauer bei Schanelec in der Dunkelheit hinter Mimi, während Sofia rückwärts darin verschwindet. Geraldo gibt, anders als Schanelec, ihr Gesicht und ihren Blick preis, der allerdings verschlüsselt bleibt, da das Blickobjekt unsichtbar ist. Diese elliptische Struktur des visuellen Erzählens steht wiederum in der Tradition von Schanelec. Auslassungen bilden ein zentrales Element in Geraldos filmischer Grammatik.
Die konstante Unterbelichtung schafft eine intime Authentizität, gleichzeitig aber auch Distanz; Sofias Konturen sind oft diffus und lösen sich nahezu in der Dunkelheit auf. Diese ständige Unterbelichtung erinnert an O Fantasma von João Pedro Rodrigues12Ebenso wie die gedämpfte, stumpfe Farblichkeit der Umgebung und einige wenige kräftige Farben, wie die rote Cap und Jacke von Sofia (die sich wie treu begleitende Konstanten durch den Film ziehen). Eine weitere zentrale Gemeinsamkeit: der dokumentarische Gestus im Fiktiven – Sofia beim Umräumen ihres Gepäcks, beim Aufbauen ihrer Tattoo-Utensilien und Sérgio in O Fantasma bei seiner Nachtschicht als Müllmann.. Allerdings gleitet das nächtliche Dasein in Sofia foi nicht auch inhaltlich und moralisch in eine Düsternis wie beispielsweise bei Rodrigues in einen animalischen, brutalen Gewaltausbruch. Statt absoluter Desillusion steht ein hoffnungsvolles, aber zutiefst traurig-zynisches Ende. Angereichert mit einer Zärtlichkeit, die in ihrer kindlichen Unschuld all die von Homophobie und Verlust ausgelösten Traumata zu berühren und zu heilen vermag. Beiden Filmen gemein ist eine gewisse Unmöglichkeit queeren Begehrens; in Sofia foi lebt physische Zärtlichkeit nur in einer traumhaften Parallelwelt. Gleichzeitig wird durch die Weerasethakulsche Selbstverständlichkeit der klanglichen, mystischen Fluidität zwischen Traum und Realität die Hoffnungsebene verstärkt. Die Klanggestaltung und Besetzung des Motifs der Natur erinnern an Apichatpong Weerasethakul, insbesondere an Blissfully Yours. Dort ist der Regenwald ein zentraler und wundersamer, traumwebender Ort, in dem sich die Menschen in einer zärtlichen Gelöstheit bewegen; aber wo auch die Anwesenheit des Verlustes latent vorhanden ist. Dies ist zentral für Sofia foi. Eine mit der Natur verbundene heilsame Transzendenz ist ein integraler, selbstverständlicher, aber doch latent bedrohlicher Teil der Realität.
Sofia foi untersucht die Gründe eines Suizids auf subtile Weise, mit Mut zu Leerstellen. Das Verschwinden wird nochmals potenziert, da es sich in der Unsichtbarkeit abspielt. Sofias letzter Kamerablick ist kurz und eindrücklich; und dann sind nur noch ihre Spuren da. Der Tag läuft grau weiter, als ihre Kleidung gefunden wird. Sie selbst taucht an einem ungreifbaren, jenseitigen oder anachronistischen Zeitpunkt in der Umschlingung mit ihrer Geliebten wieder auf. Eine geerdete Entmaterialisierung, die zutiefst bewegt. Die Kraft der queeren Utopie ist selten so kathartisch, real und abstrahiert zugleich. Geraldos Debütfilm ist sich sowohl seiner Referenzen, als auch seiner eigenen markanten Bildsprache bewusst, die dezent und präzise ist. Jede Einstellung ist ein Aufleben und Vorübergehen. Abwesenheit und Anwesenheit, Verbergen und Erscheinen, Abklingen und Aufglühen, Kälte und Wärme, Schmerz und Hoffnung werden zu fluiden Seinszuständen verknüpft. Dennoch ist es ein schlichter Film, der am Ende so sanft und nüchtern verklingt wie seine Protagonistin.
Auf dem Arm des Mannes, der Sofias nasse Kleider zum Trocknen ausbreitet, ist ein Tattoo flüchtig zu sehen. Ein von einem Dolch durchstochenes Herz. Wasser tropft schwer und schwerelos auf eine schwarze Fläche. In diesen Wassertropfen traf die Tragik und die utopische, schlichte Hoffnung von Sofia foi direkt ins Herz. Und Tränen, die der Film in seiner Erdung nicht weint, wurden zu realen Tränen.
Notes
- 1Duras, Le noir atlantique, in: Des femmes en mouvements, Nr. 57, Paris 1981, p. 30-31.
- 2Ebd.
- 3Ebd.
- 4Pessoa, Le Marin, Éditions Corti, Paris 1989, S. 53.
- 5Ebd., S. 25.
- 6Susan Sontag, Notes on ‘Camp’, Penguin, London 2018, S. 1.
- 7Ebd., S. 9.
- 8Ebd., S. 15.
- 9Zitat aus dem Film.
- 10Wilde, The Importance of Being Earnest, Dover Thrift Editions, 2020, S. 6.
- 11Susan Sontag, Notes on ‘Camp’, 2018, S. 4-6.
- 12Ebenso wie die gedämpfte, stumpfe Farblichkeit der Umgebung und einige wenige kräftige Farben, wie die rote Cap und Jacke von Sofia (die sich wie treu begleitende Konstanten durch den Film ziehen). Eine weitere zentrale Gemeinsamkeit: der dokumentarische Gestus im Fiktiven – Sofia beim Umräumen ihres Gepäcks, beim Aufbauen ihrer Tattoo-Utensilien und Sérgio in O Fantasma bei seiner Nachtschicht als Müllmann.




