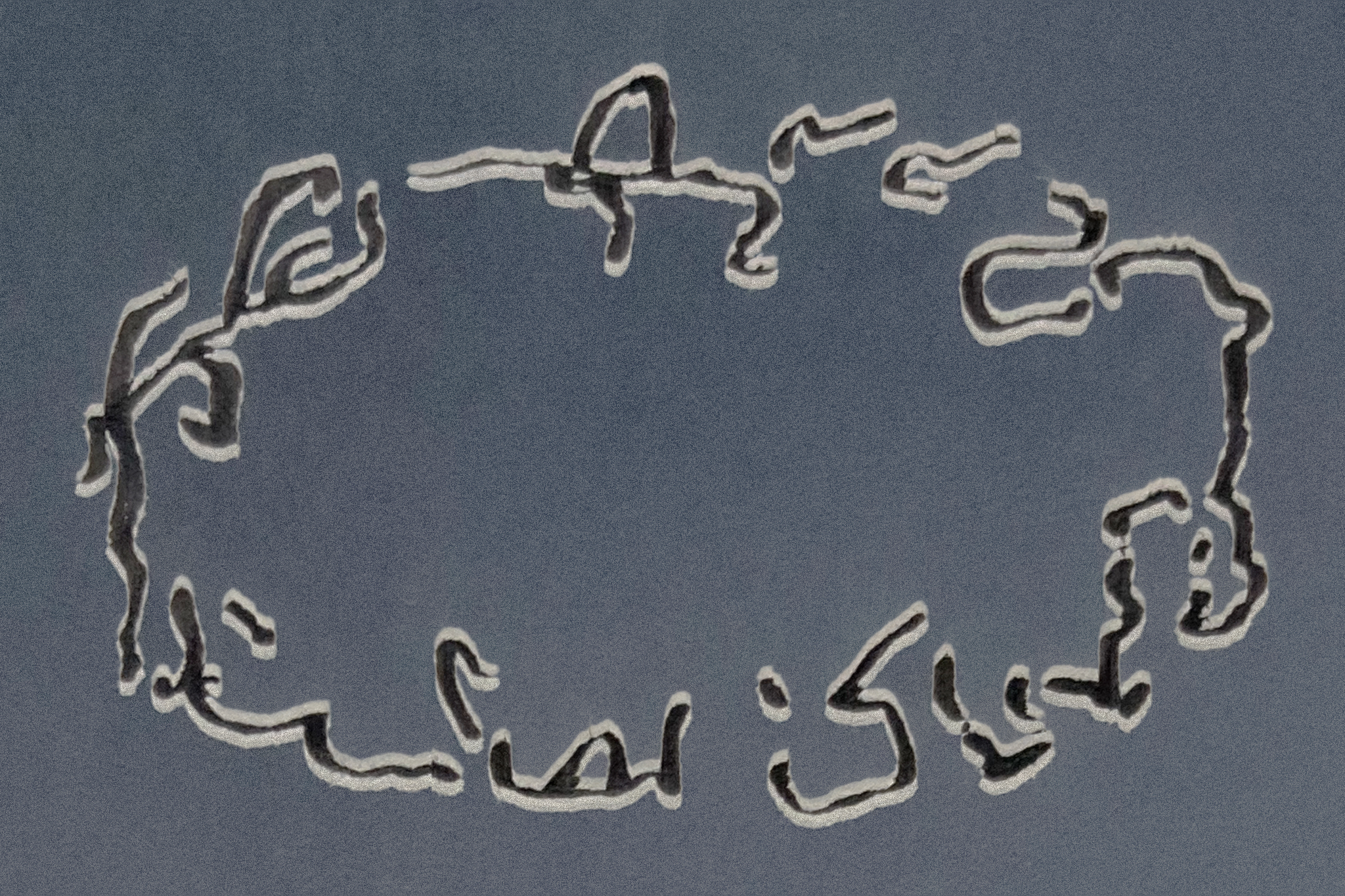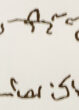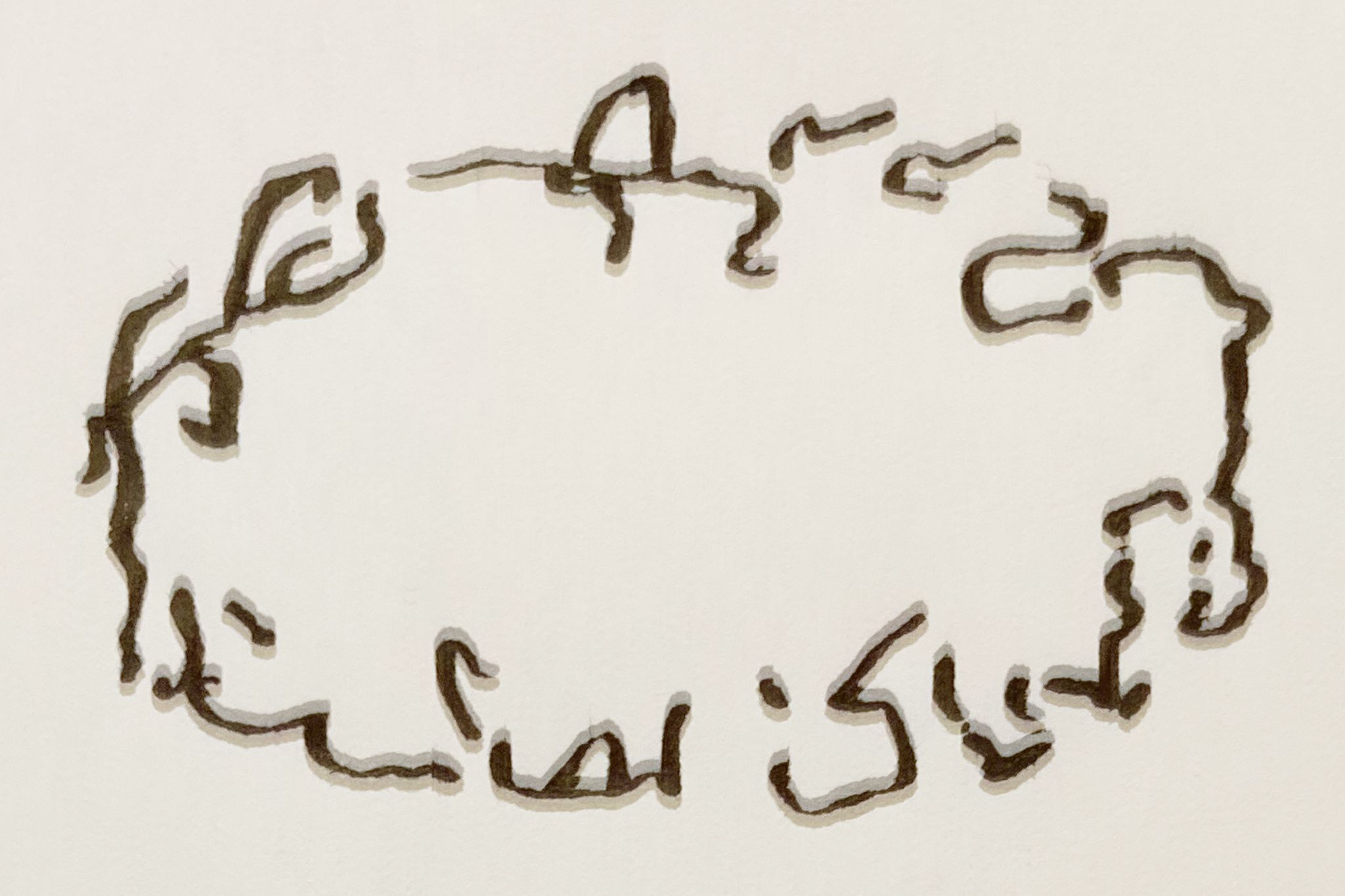
Als wir uns noch öfter gesehen haben
Es mag sein, dass die Notwendigkeit die Menschen dazu zwingt, miteinander verbunden zu sein, um zu beweisen, dass der Mensch keine Insel ist. Diese einfache Prämisse fesselt die Menschheit an eine Reihe von Tests oder Koordinationsspielen, die am häufigsten im Gefangenendilemma verkörpert sind. Kooperation oder Verrat, diese Wahl, ohne Kommunikation getroffen, führt zu ewigen Fragen danach, ob die in der Gesellschaft konstruierten Gefüge jemals optimal sein können. Natürlich verbleiben in diesen Interaktionen Reste, die von expliziten Formalisierungen der Kooperation nicht angemessen erfasst werden können, um nicht ihren eigentlichen Sinn zu verlieren. Um diese Reste entsteht das Durcheinander des Lebens, welches Interaktionen komplizierter gestaltet, als sie eigentlich sein dürften. Schmerzlich und niederträchtig schafft die transaktionale Natur kaltherziger Kollektive Schachfiguren in jeder Interaktion.
Die Akkordeonstruktur von Wrubels Debütfilm lässt sich nicht von Anfang an erahnen, und vielleicht liegt darin die wahre Stärke seiner vollständig filmischen Entschlossenheit, Bild und Ton als eigenständige Elemente wahrzunehmen. Wenn Dinge einfach neu erzählt werden könnten, dann würde Film nicht funktionieren; gäbe es eine eindeutige Erklärung, eine klare Argumentation, dann würde dieses Werk schlichtweg nicht existieren. Für jene, die alles explizit machen wollen, ist das Implizite eine Last, ein Hindernis auf dem Weg zur Klarheit. Statt sich vom Unbekannten treiben zu lassen, suchen sie nach Antworten. Wrubels Ansatz jedoch ist so, dass sich die Interaktionen von rein inhaltlichen Analysen lösen: „Als wir uns noch öfter gesehen haben“ beschäftigt sich mit Körpern, die etwas in der Luft zurücklassen, die sie atmen; ihre Gesten und ihre Art zu blicken hinterlassen Spuren. Die Körper stehen kurz vor dem Zerbrechen, tun es aber nicht vor der Kamera.
Wenn eine Figur eingeführt wird, dann, um ein Beziehungsgeflecht zwischen ihr und den anderen zu erschaffen. Wenn eine Figur zurückkehrt, geschieht dies aufgrund von Echos. Linien verlaufen parallel, Menschen begegnen einander, ohne sich wirklich zu treffen. Der Klang eines Flugzeugs nähert sich, eine Gestalt im Wald blickt auf, spürt den Klang. Die Einstellung verbirgt sich hinter Bäumen. Das Grün wird dunkler, tiefer. Die Gestalt scheint abzusteigen. Eine andere Person blickt mehr nach unten als nach oben, riecht etwas und geht weiter. Beide Körper dringen tief in das Dunkelblau ein, und dort bleiben sie. Die folgende Unterhaltung gibt einen Einblick in eine Beziehungsdynamik, in einen Moment des Widerspruchs innerhalb der präsentierten Körper. Autos, Säfte, das Geräusch des Reisens.
Wenige Momente später zeigt dieselbe Person ein Zimmer in einer Wohnung. Eine kreisförmige Einstellung folgt Menschen, die Deutsch lernen und laut lesen. Es ist kein Zufall, dass Sprachelemente immer wieder auftauchen und dabei eine eigene Bedeutung gewinnen; es ist auch kein Zufall, dass die Figuren der ersten Szene Griechisch sprechen. Die Menschen, die eine Sprache lernen, werden lose durch eine Sprache zusammengehalten, die sie noch nicht beherrschen und vielleicht auch nie ganz beherrschen werden. Die Kamerabewegung setzt sich fort, selbst wenn keine erkennbare menschliche Figur mehr vor ihr ist. Eine Figur trifft auf eine andere. Der Kreis setzt sich fort. Und dies ist die Realität von Zeit und Raum, wie sie von Homo sapiens konstruiert wird, sie setzt sich fort, selbst wenn die Kamera nicht hinschaut. Die erodierten Momente erzeugen Wellen, die von den Figuren als Umgebungspräsenz gespürt und eingefangen werden.
Wenn dem Flaneur, der Psychogeografie oder der Konstruktion einer kognitiven Karte irgendein Wert zukommt, dann vielleicht durch die Wiederkehr bestimmter Orte mit spezifischen Bedeutungen, Gerüchen, Berührungen und Blicken. Das Theater, die Wohnung, die Bibliothek, der Klassenraum, das Schlafzimmer, der Bahnhof, der Park, die Bar. Es gibt keinen Raum ohne Transit, keine Person ohne Raum. Dennoch wird an diesen Orten nicht krampfhaft um Bedeutung gerungen. Vielleicht wurde diese Schlacht längst aufgegeben in der Suche nach Produktion, und Figuren und Elemente erkennen möglicherweise nicht einmal, was sie tun, wie sie gehen, wie sie schauen oder hören, und vor allem, was sie nicht tun. „Mein armes Mädchen, diese Leute sind verrückt.“
Die filmische Welt öffnet sich, löst sich von den Nahaufnahmen, in einer Totalen einer Person, die in einem unbestimmten Teil der Stadt unterwegs ist, ohne Haltung, aber in Bewegung. Diese Verschiebung ist ein Schmerz, der keiner Erklärung oder expliziten Linie bedarf. Diese Figur liest ein Buch, interagiert mit jemand anderem, eine Erinnerung daran, dass alle Objekte von Menschen durchquert wurden und diese Objekte ebenso durch Menschen wandern. Ein Satz in einer Probe, ein Gespräch beim Wäscheaufhängen, Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn es so etwas wie Anmut in der Welt gibt, dann etwas, das nicht angestrebt wird, nicht zielgerichtet ist. Es ist so einfach wie ein Buch, das auf dem Tisch liegt, ein kurzer Blick des Wiedererkennens, der nicht verweilen kann.
In „Als wir uns noch öfter gesehen haben“ ist die Zeit bereits vergangen, sie ist fort, der Ort der Sprache liegt im Perfekt, eine Erinnerung an Elemente, spezifisch platziert, nah an der Kamera, in einer Ecke, mit dem Rücken zum Betrachter. Die Dinge sind fort. Sie kommen nicht zurück. Doch in dieser Erinnerung könnten einige Besonderheiten gefunden werden, Momente der Möglichkeit, in denen die Welt offener erschien, bereichert von einer kaskadierenden Sehnsucht nach etwas mehr. Dass dies nicht stabil bleibt, sondern zu einer Wendung in einem Park wird, zur Suche nach einem Foto in einem Bahnhof, zeugt von einem Verständnis jener kleinen Momente, die in der Erinnerung auftauchen, nur um vom Kommenden verdrängt zu werden. Vielleicht beginnt ja ein neues, gebrochenes Leben.