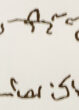Saint Omer: Fremde Augen, lautes Schweigen
„Und siehst du meine Tränen überhaupt,
wenn ich nicht bin wie du?“
– Hans Henny Jahnn, Medea
Die ersten Sätze in Euripides‘ Medea stammen nicht aus dem Mund der tragischen Titelfigur, „unglücklich, entehrt, […] schrecklich1Euripides (2022): Medea. Übersetzt von Paul Dräger. Ditzingen [2011]. V. 20, V. 43.“, stattdessen ist es Medeas Amme, die ihre Herrin mit diesen Worten beschreibt. Von außen blickt sie auf den Mittelpunkt der Geschichte und leitet so die Tragödie ein. Nun nimmt Alice Diops distanzierte, verschobene, brüchige Neuinterpretation diese Fremdwahrnehmung, den Blick der Anderen, als Ausgangspunkt, der sich auf die gesamte Versuchsanordnung ausweitet. Denn an den Rändern hat man oft einen besseren Blick auf den Kern der Sache.
Im Auge des Sturms befindet sich also eine neue, alte, ewige Medea – Médée naufragée („schiffbrüchige Medea”), wie sie Rama im Titel ihres Buchs nennt. Auch diese Medea ist Mutter, war es, war und ist Frau eines fremden Mannes in einem fremden Land. Sie ist Guslagie Malanda, Laurence Coly, Fabienne Kabou und vielleicht auch Maria Callas, deren Gesicht sich neben, unter und über die anderen legt. Nicht nur in diesem Sinne ist die Angeklagte im Zentrum aller Blicke ein Palimpsest, schwimmen doch stets neue Assoziationen alter Bilder an die Oberfläche.
Diese Medea spricht auch von Zauber, dunkler Magie. Eine Erklärung, die als Chiffre im Raum stehenbleibt. „Manche Dinge kann man nicht klarer sagen“, erwidert sie an einer Stelle auf wiederholte Nachfragen der Anwälte. Die einen sprechen von „Wahnsinn”, die anderen von kulturellen Unterschieden. Verstanden wird sie von niemandem. Es wird nahegelegt, dass es sich um eine wohl überlegte Verteidigungsstrategie handelt („Schämen Sie sich nicht für Ihre Kultur, wenn sie Ihnen helfen kann, uns Ihre Tat begreiflich zu machen.“), aber letztendlich lässt sich keine Wahrheit ergründen. Die Leere bleibt. Ein Wort, von dem auch Laurences Mutter spricht: „Ihre Leere, die Leere in ihr, sie wurde absichtlich gemacht.“ Wer diejenigen sind, die diese Leere schufen, „die das wirklich getan haben“, sie Schritt für Schritt von innen heraus ausnahmen, das muss an dieser Stelle nicht mehr gesagt werden. Diese Leere füllt den Raum zwischen ihnen und den Anderen. Es ist also diese fundamentale Lücke, die das Herzstück des Films bildet. Ein gähnender Abgrund steht zwischen Laurence und der Rechtsordnung, zwischen Senegal und Frankreich. Es ist dieselbe Leerstelle, die Richard Dyer in einem Text zu David Leans A Passage to India beschreibt: „the point is that they do have meaning but not one that the [colonizer] can fathom2Dyer, Richard (1993): The Matter of Images. Essays on Representation. London/New York. S. 138..”
„Dass diese Spaltung die unmittelbare Folge des kolonialistischen Abenteuers ist, daran besteht kein Zweifel3Fanon, Frantz (1985): Schwarze Haut, weiße Masken. Frankfurt am Main [franz. 1952]. S. 14.“, schrieb Frantz Fanon in Schwarze Haut, weiße Masken. Die Spaltung, von der er spricht, hat etwas mit der vorherigen, kulturellen, zu tun, ist aber noch essenzieller, noch ausschlaggebender und unumgänglicher: Die Spaltung, von der er spricht, das ist die Sprache. „Denn sprechen heißt, absolut für den anderen existieren.4Ebd.“ Nun ist hier also Laurence Coly, der man in ihrer Kindheit im Senegal verbot, Wolof zu sprechen. „Perfekt Französisch […] und nur Französisch“ sollte es sein. Eine von Beginn an für den Anderen angelegte Existenz, die zu Grunde geht, als sie nach Frankreich auswandert. Denn ankommen in einem fremden Land, in einem Land, das nur die Andere sieht, das heißt auch, hier nur noch die Andere zu sein. So ist sie nun also in Frankreich und somit ist auch die Sprache, in der sich ihr Urteil, ihr Gesehen- und Ergründet-werden in diesem juristischen Kontext ausdrücken muss, Französisch. Die Sprache der Anderen, die etwas anderes nicht zulässt. „Jedes kolonisierte Volk […] situiert sich im Hinblick auf die Sprache der zivilisatorischen Nation5 Ebd., S. 15.“. Situieren tut sie sich, ja, in diesem Sprung über den Abgrund kann jedoch nicht jedes Detail übernommen werden. Es ist ein Akt, der sich der Definierbarkeit hingibt, sich ihr jedoch zur gleichen Zeit verweigert. Gewisse stellen bleiben leer, bleiben stumm, müssen es, um zu überleben. „Wie verstehen Sie dieses Schweigen?“, wird die Richterin später fragen.
In ihrem Essay „Variations on the Right to Remain Silent” arbeitet Anne Carson eine spezifische Qualität gewisser Worte heraus, die unübersetzbar bleiben, auf ihre eigene, komplexe und herausfordernde, Art ‚schweigen‘: „But now what if, within this silence, you discover a deeper one – a word that does not intend to be translatable. A word that stops itself.6Carson, Anne (2016): Float. New York. S. 1. Die Sammlung Float, die diesen Aufsatz enthält, besteht aus unnummerierten Heften in unsortierter Reihenfolge, die jeweils keine Seitenzahlen enthalten, für Referenzzwecke gebe ich hier die Seitenzahlen des Hefts „Variations on the Right to Remain Silent“ an.” Ein Wort, das in seiner Auslegung nicht dazu gedacht ist, übersetzt zu werden, das sich dem Prozess der Aneignung durch eine andere Person, eine andere Sprache, einen anderen Blick entzieht. „[Y]ou can pronounce them but you cannot define, possess or make use of them7Ebd., S. 2..” Laurence Coly ist solch ein Wort. Sand im Getriebe, der einen Prozess, ein ganzes System, offenlegt. Tagelang versucht die Justiz, diese Frau zu verstehen – ihre Identität, ihre Geschichte, ihre Beweggründe auszumachen – und mit jedem Tag wird die Sicht auf sie undeutlicher. Diese Angeklagte spricht und schweigt zur selben Zeit. Zwischen den Holzvertäfelungen und den meterhohen Fensterscheiben ist sie das Gravitationszentrum, das alle Blicke auf sich richtet, aber sich niemandem zu verstehen gibt. „Eine Frau, die niemand sieht. Die niemand kennt.”
Weiter schreibt Carson über das Phänomen unübersetzbarer Worte: „Almost as if you were presented with a portrait of some person – not a famous person but someone you might recognize if you put your mind to it – and as you peer closely you see, in the place where the face should be, a splash of white paint8Ebd..” In der Sprache der Anderen kann der Signifikant nichts mehr bedeuten. Die Mitte ist leer. Der fremde Blick scheitert immer wieder in seinem Versuch zu interpretieren, zu analysieren, also: mit (neuer, eigener) Bedeutung zu füllen. weiße Farbe verdeckt Schwarze Gesichter.
Ein anderes Beispiel, das Carson in ihrem Text aufgreift, ist der Fall von Jeanne d’Arc, deren Leben und Leiden ebenfalls in diesem Gerichtssaal, einem Raum voller Echos, aus der fernen Vergangenheit nachhallt. Die ‚Jungfrau von Orléans‘ also – noch eine Frau vor Gericht, noch eine Frau, die von ‚Stimmen‘ spricht. Auch ihr erging es ähnlich, vor den Augen aller sollte sie das ergründen, was ihnen fremd war. „They wanted her to name, embody and describe them in ways they could understand, with recognizable religious imagery and emotions, in a conventional narrative that would be susceptible to conventional disproof9Ebd., S. 3..” Konvention, das wäre wohl auch ein Film in einem Gerichtssaal – kein Gerichtsfilm –, der in einem Urteil endet. Darauf lässt sich die undeutbare Frau im Mittelpunkt jedoch nicht festnageln, entgleitet unseren Blicken so plötzlich, wie sie auch schon hineingeglitten war. Auf einmal ist die Gerichtsbühne leer, der Vorhang fällt, das Schauspiel ist vorbei und alle Stimmen, von denen hier je die Rede war, verstummen.
‚Stimmen‘, das sind in diesem Gerichtssaal zudem ganz konkrete, von Anwälten, Richtern, Zeugen. weiße Stimmen, die unserer Schwarzen Angeklagten ihre Stimme rauben. In einem Schlüsselmoment sehen wir Laurence lange im Profil. Ihre Worte sind zu hören, nicht aus ihrem Mund, gefiltert durch ein Protokoll und eine Anwältin, die sich wie Schichten über sie legen, sie in ihren Worten erdrückend fixieren bis zuletzt ihre Stille Überhand gewinnt und alles andere zum Schweigen bringt. Jenseits des Stimmenwirrwarrs im Raum dreht sie ihren Kopf zu uns, zur Zuschauerin, diesem bekannten Gesicht in der Menge, und hebt die Mundwinkel an, kurz, entschlossen. Ein Paar Augen und ein Lächeln. „Wie verstehen Sie dieses Schweigen?“
Erste Referenzen für die Bildsprache des Films waren laut Alice Diop Gemälde: „‚La Belle Ferronière‘ von Da Vinci, einige Rembrandts, von Cézanne gemalte Schwarze Modelle, und eines in der MET, ‚Grape Wine‘ von Andrew Wyeth, das Porträt eines Schwarzen Vagabunden, gemalt wie es Tizian gemalt haben könnte.10Grandfilm (2022): Saint Omer. Alice Diop. Presseheft. Nürnberg. S. 5.“ Dass das Anliegen des Films auch ein visuelles ist, wird schnell klar. Wenn Menschen aus einem Off ins Bild gerückt werden, ist dort auch immer eine Andeutung von dem, was war – „Die Erzählung besteht darin diese Haut, diese Körper festzuhalten, an einem Ort, an dem sie noch kaum sichtbar sind11Ebd.“ – Sichtbarkeit als Reaktion auf Unsichtbarkeit. Laurence ist also eine Frau in einer paradoxen Position: Sichtbar gemacht – als Angeklagte vor Gericht, als Schwarze Frau in ihrer Differenz markiert – und zugleich unsichtbar, die Konturen ihres Körpes, gekleidet in einem hellen Braun, drohen im Gerichtssaal oft vor dem hölzernen Hintergrund zu verschwinden. Wir sehen die „Phantomfrau”, von der die Anwältin in ihrem Plädoyer spricht.
Diese historisierende Sicht auf die Angeklagte, ihren Körper und ihren Blick, eröffnet in Verbindung mit den mythologischen Verstrickungen noch eine andere Perspektive. So war die Figur der Medea nicht nur in der Literatur über Jahrhunderte ein großer Einfluss, den es immer wieder neu zu interpretieren galt. Ein in diesem Kontext besonders passendes Beispiel – wieder eine Art Echo aus der Vergangenheit, wie der Film auch eine Vermischung realer Ereignisse und deren Übertragung in die Kunst: Margaret Garner, eine junge Sklavin, floh 1856 mit ihrer Familie in den Norden. Als die Sklavenhalter sie umzingelt hatten und sie keinen Ausweg mehr sah, beschloss sie, ihre zweijährige Tochter mit einem Schlachtermesser zu töten. Elf Jahre nach den tragischen Ereignissen stellt Thomas Satterwhite Noble ein Gemälde aus – Margaret Garner or The Modern Medea. Darauf ist der Moment zu sehen, in dem die Sklavenhalter (links) Garner und ihre Kinder (rechts) auffinden, sie sind in die Ecke des Raumes gedrängt. Beide Seiten deuten mit ausgestrecktem Zeigefinger auf die Mitte des Bilds, die Lücke, den Abgrund, zwischen ihnen, in der die Leiche von Garners Kind – in dieser Adaption ein Junge – auf dem Boden liegt. In den weißen Gesichtern auf der linken Seite: Schock, vielleicht sogar Schrecken. Einer der Männer blickt mit weit aufgerissenen Augen zum Rest der Gruppe, fassungslos, alarmiert. Rechts das Schwarze Gesicht einer Mutter, die soeben das Unvorstellbarste getan hat. In ihren Augen: Wut. Ihre Hände zeigen nicht nur, sie sind leicht geöffnet, mit den Flächen nach außen, als würde sie den anderen ihre Tat präsentieren. Mit gebleckten Zähnen und zusammengezogenen Brauen starrt sie entschlossen hinüber zu den Männern, die ihren Blick meiden, sich gegenseitig ansehen, den Jungen am Boden, alles, nur nicht sie. Denn was sie mit ihrer Pose sagt: Ihr habt das getan. Es ist auch das, was Laurence Coly zu ihrer Mutter gesagt hat: „Sie müssen wissen, wer die Leute sind, die das wirklich getan haben.“

Margaret Garner or The Modern Medea (Thomas Satterwhite Noble, 1867)
Diese Männer sind Sinnbild einer weißen Gesellschaft, die ihren selbst verursachten Krisen nicht in die Augen sehen kann. Es sind die weißen Richter und Anwälte im Gerichtssaal, die den Prozess vollziehen, sich also mit Laurence auseinandersetzen, oder das zumindest vorgeben, aber weiterhin nicht auf den Ursprung des Problems schauen wollen. Denn ihr Problem ist die Tat, Laurences Problem, das eigentliche Problem, ist die Ursache der Tat. Eine Ursache, die von den USA des 18. bis ins Frankreich des 21. Jahrhunderts nicht ausgesprochen werden soll. So kann die Angeklagte auch nur von den Dingen sprechen, nach denen sie gefragt wird. Es ist klar, dass ein Gesellschaft, die sich selbst verhört, sich niemals überführen wird. In ihrer Stille konfrontiert Laurence dieses System also mit seinem eigenen Schweigen, erwidert es und lässt die Schuldtragenden in ihrer willentlichen Ignoranz verbleiben.
Alice Diop sprach bereits von Rembrandt, Anne Carson kommt ebenfalls auf ihn zurück, in der Beschreibung von einem seiner späten Selbstporträts. Es ist ein zunächst unscheinbares Gemälde – der Künstler als alternder Mann blickt geradeaus. Jedoch scheint das Bild von einer Dunkelheit besessen, die bei längerem Betrachten den ganzen Bildraum einnimmt. Die untere Bildhälfte ist fast gänzlich schwarz – auch hier wieder eine Leerstelle, die in ihrem Schweigen spricht. Diese Dunkelheit, in der sich Rembrandts Konturen verlieren, ist auch die Dunkelheit, die in seinen Augen liegt. Das, was Carson in diesen Augen sieht, meine ich auch in Guslagie Malandas Augen zu erkennen, wenn sie Rama anblickt: „These eyes are not blind. They are engaged in a forceful looking but it is not a look organized in the normal way. Seeing seems to be entering Rembrandt’s eyes from the back. And what his look sends forward, in our direction, is a deep silence12 Carson 2016, S. 12..” Ein Schweigen liegt dort, wo sie uns anblickt, eine Stille. Wenn man aber genauer hinhört, mit den eigenen Augen hinsieht, meint man, in der Leere die letzten Überreste von etwas Unbekanntem ausmachen zu können. Etwas, das uns seine, ihre Geschichte erzählen kann. Nennen wir es ‚Stimmen’.

Selbstbildnis (unvollendet) (Rembrandt van Rijn, 1659)
Guslagie Malandas Augen. Es ist der Blick einer Frau, die als faszinierender Fremdkörper in der Mitte eines Films und doch an ihm vorbei existiert. Über die man nach zwei Stunden mehr weiß, Fakten und Details werden genannt, aber ich frage mich doch, ob man sie viel besser versteht. Zumindest hat man sie nun gesehen. Ich denke, dass es Rama ähnlich gehen muss. Auch wenn ihr Blick ein anderer, fremder, ist, ist diese Andere, die blickt, weniger anders als die anderen – weißen – Menschen vor und auf der Gerichtsbühne. Rama erkennt vieles in ihr, was sie kennt. Deswegen die Faszination, das Verlangen, nach Saint-Omer zu fahren, Zuschauerin zu sein, Zeugin dieser enigmatischen Persönlichkeit. Irgendwann – Endlich? Leider? – blickt das Blick-Objekt zurück, ein Blick, ein Blickwechsel, den ich immer noch nicht ganz zu deuten weiß. Womöglich geht es Rama auch so und deswegen bricht sie in Tränen aus. Ein Paar Augen und ein Lächeln. Der Blick als freundliche Geste der Verbundenheit? „Du siehst mich, ich sehe dich.” Warum dann also Ramas Tränen? Ist es doch eher das „spöttische Achselzucken13Wolf, Christa (2001): Medea. Stimmen. München [1998]. S. 9.“ von Christa Wolfs Medea? „[E]in Wegwenden, sie braucht unseren Zweifel nicht mehr, nicht unser Bemühen, ihr gerecht zu werden, sie geht14Ebd..“ Möchte sie womöglich gar nicht verstanden werden? Ja, sie sind sich wohl ähnlich, diese beiden Frauen, aber in der unüberwindbaren Distanz des Zusehens, des Eine-Andere-Seins, bleibt doch die Lücke, die Rama sagt, dass auch sie die Andere nicht gänzlich verstehen kann. Sie kommt hierher, die Geschichtenschreiberin, um aus dieser Frau eine Geschichte zu machen, einen Mythos, obwohl sie doch gar nicht weiß, wen sie da vor sich hat. In diesen wenigen Sekunden eröffnet die Stille zwischen Laurences und Ramas Augen ein ganzes Universum an Möglichkeiten. Eine Netz von Ambiguitäten, das sich nicht mehr auflösen lässt. Während Rama die Angeklagte zuvor mit Deutungen überfrachtet hat, wird Laurences Blick nun zu einem Spiegel, der ihr all diese Zuschreibungen gleichzeitig zurückwirft: die Schuldige oder die Unschuldige, die Schwarze Mutter, mit der sie sich identifiziert, eine Medea, Variation der unendlichen Tragödie. Die stumme Zuschauerin spürt die Last, die sie der Angeklagten auferlegt hat, hält es nicht länger aus und muss ihrem Blick ausweichen.
Kayije Kagames Augen. Rama blickt zu ihrer Mutter, die im Halbschlaf auf der Couch sitzt, tief ein- und ausatmet. „So müde“, sagt sie. Die Hände der beiden Frauen liegen ineinander. Nun dreht Rama ihren Kopf zu uns, schaut mit den müden Augen ihrer Mutter nicht mehr hinter sich, sondern nach vorne, atmet ebenfalls tief ein und aus, wirkt trotz ihrer Trägheit etwas nachdenklich. Wohin ihr Blick führt, wissen wir in diesem Moment nicht. Ihr gegenüber an der Wand steht – das haben wir schon einmal gesehen – ein Fernseher auf einem kleinen Tisch, links daneben eine Vitrine, in der ein paar ihrer Kindheitsfotos aufgestellt sind. Über dem Fernseher hängt in einem goldbraunen Rahmen das Herzstück dieser Wohnzimmerwand – eine Kopie der Mona Lisa. Ein Paar Augen und ein Lächeln.
Teoman Yüzer absolviert gerade sein Masterstudium Filmwissenschaft in Mainz. Zuvor hat er Theater- und Medienwissenschaft in Erlangen studiert. Er interessiert sich für Mythos im Kino, digitale Bilder, filmische Texturen und Zooms.
Notes
- 1Euripides (2022): Medea. Übersetzt von Paul Dräger. Ditzingen [2011]. V. 20, V. 43.
- 2Dyer, Richard (1993): The Matter of Images. Essays on Representation. London/New York. S. 138.
- 3Fanon, Frantz (1985): Schwarze Haut, weiße Masken. Frankfurt am Main [franz. 1952]. S. 14.
- 4Ebd.
- 5Ebd., S. 15.
- 6Carson, Anne (2016): Float. New York. S. 1. Die Sammlung Float, die diesen Aufsatz enthält, besteht aus unnummerierten Heften in unsortierter Reihenfolge, die jeweils keine Seitenzahlen enthalten, für Referenzzwecke gebe ich hier die Seitenzahlen des Hefts „Variations on the Right to Remain Silent“ an.
- 7Ebd., S. 2.
- 8Ebd.
- 9Ebd., S. 3.
- 10Grandfilm (2022): Saint Omer. Alice Diop. Presseheft. Nürnberg. S. 5.
- 11Ebd.
- 12Carson 2016, S. 12.
- 13Wolf, Christa (2001): Medea. Stimmen. München [1998]. S. 9.
- 14Ebd.