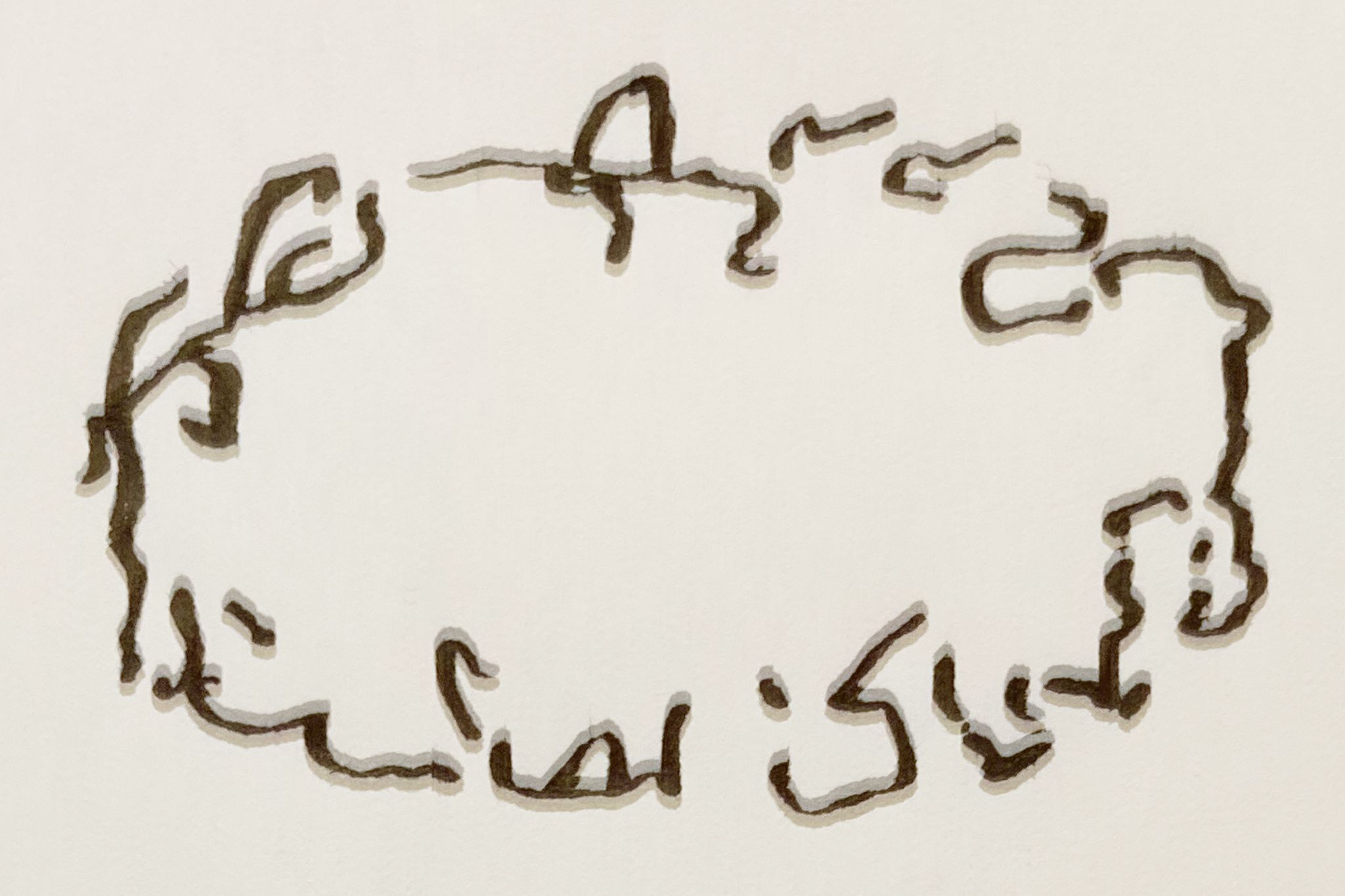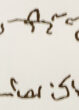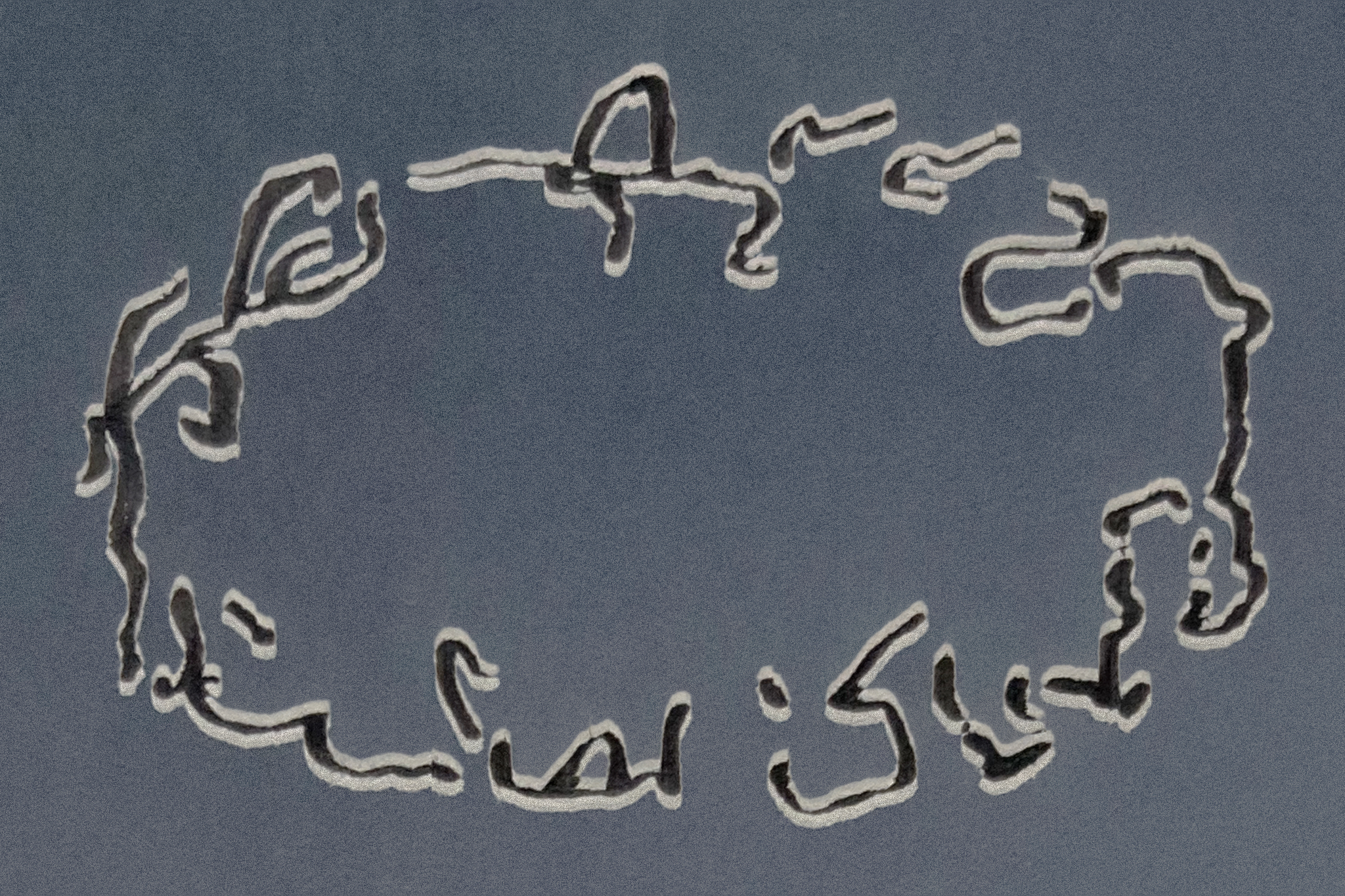
Geister Film
Die hier besprochenen Filme werden ab dem 13. Juni einen Monat lang auf Nirgendwo laufen.
Eine der faszinierendsten Möglichkeiten, die Grenzen der eigenen Kognition zu erfassen, besteht darin, Zeuge eines Unerklärlichen zu werden, eines Phänomens jenseits dessen, was sich selbst für begreifbar hält. Wie kann etwas in Einklang gebracht werden mit dem eigenen Weltbild, wenn das betreffende Phänomen dem, was bislang als bekannt galt, schlichtweg widerstrebt? Die Antworten darauf variieren. Eine Möglichkeit ist, ein Glaubensgefüge zu bilden, das das Gesehene umdefiniert, es gewaltsam in eine symbolische Vorstellungswelt integriert, damit es Sinn ergibt. Andere bevorzugen die Ablehnung des Phänomens, wodurch es zu einem traumatischen Streitpunkt erhoben wird. Dieses X, das sich nicht an ein kohärentes Weltbild anpassen lässt, bleibt aus schierer Willenskraft außen vor. Aus Selbstschutz verweigern res extensa und res cogitans jede Neubestimmung des Weltbildes.
Mit Anbruch einer neuen Epoche wurden den Sprachphilosophen endlich Blumen gestreut. „Was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden.1Wittgenstein 4.1212. Tractatus Logicus Philosophicus.“ Der überwiegende Teil der heutigen Welt, und auch die künftige posthumane, soll auf Sprache gründen; verstanden als Textsequenz, logische Verkettungen, ein Hin- und Herwerfen von Worten. Wenn der Fluch darin liegt, dass der Handelnde gezwungen ist, frustrierend oft dieselben Worte zu wiederholen, um verstanden zu werden, so gilt dies dennoch als Schritt in die richtige Richtung. Sprache ist, so scheint es, Verdammnis und Gnade zugleich. Das Phänomen, das jenseits der Grenzen des Begreifbaren erscheint, ist entweder etwas, das unermüdlich versprachlicht werden muss, oder etwas, das man überhaupt zu vermeiden sucht in Worte zu kleiden.
Dass das Gezeigte nicht gesagt werden kann, mag als unumstößliches Faktum im Leben eines Menschen existieren, doch läuft dies frontal gegen die Möglichkeit einer figurativen Analyse des Films, zumindest in ihren strukturalistischsten Formen. Die Beschreibung eines Menschen, der auf dem Rücksitz eines Wagens ins Nichts starrt, eine sorgfältige Auflistung jener Arten, wie einige Menschen das Offensichtliche umkreisen, oder eine Person, die vor einer anderen singt, all dies sind Phänomene, die gleichsam wie durch Zauber aus dem Nichts heraufbeschworen wurden, durch die Entwicklung der Technologie des Films, sei sie nun chemisch oder digital2Diese Unterscheidung gilt nur insofern, als dass man damit ausschließt, dass es sich bei Digitalkameras auch um Chemikalien handelt, was aber die Traditionalisten des Films beruhigt.. Diese Phänomene werden in die gegenwärtige kapitalistische Maschinerie integriert als neue Erzählungen, die assimiliert, als Vorlage für das eigene komplizierte Leben genutzt werden sollen, um es zu entziffern.
Die Figuration, die Fleischwerdung des Wortes, kann wieder in ihre weltliche Form zurückgeführt werden. Doch im Gegensatz zur Umwandlung des Films in eine neue Normalität mittels Zwangsernährung, kann die Analyse des Figurativen verdeutlichen, wie man zum Unbegreiflichen zurückkehrt, zu einem Phänomen, das sich der Erklärung und pädagogischen Zurichtung entzieht. Diese Methodologie der Verfremdung versteht die Bilder und Klänge des Filmischen als herausragende Elemente, die eine neue Normalität der Wiederverzauberung der filmischen Welt ermöglichen könnten, anstatt als bloße Vorlagen zu dienen, um die Welt entzifferbarer, verständlicher und weniger fremd erscheinen zu lassen. Es handelt sich hierbei natürlich um ein wohlbekanntes Terrain für jene, deren Worte oft fehlinterpretiert werden, für jene, die zur Missverständlichkeit neigen, für jene, die Schönheit in einer spezifischen Anordnung oder Konstellation von Elementen erkennen, welche manchmal entgleiten und manchmal bleiben. Doch da sind sie nun einmal.
Die kollektive Form hat in ihrer künstlerischen Ausprägung zahlreiche Gruppen hervorgebracht, die sich im Namen von etwas vereint haben, das größer ist als sie selbst. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, denn die Unpersönlichkeit eines Ideals ist jener verbindende Kitt, auf dessen Grundlage viele Berufungen gedeihen können. Die Klarheit, mit der das Hamburger Kollektiv Geister seine klar definierten Aufgaben formuliert, lässt sich bereits in den ersten Bildern ihrer Filme erkennen. Marlon Weber, Sandra Malkhouf und William Wrubel verstehen ihr Metier als eine Umsetzung der Einfachheit, die darin besteht, die bloße Resonanz zwischen Körpern und die Erschaffung von Welten zwischen den einzelnen Bildern zu begrüßen.
Filmkollektive, wie jede kollektive Formation, verstehen sich selbst durch bestimmte Verpflichtungen, die affirmieren und ablehnen. Doch gerade das Ablehnen spezifischer Elemente dient oft dazu, sich deutlich abzugrenzen. Tatsächlich verschmähten viele Kollektive im Film bestimmte Strömungen, ganz zu schweigen von ihren internen Reibungen. Beispiele aus Frankreich und Dänemark sind immer schon präsente Worte der Filmgeschichte, doch die mit ihnen verbundenen Vorstellungswelten legen ihren Schwerpunkt auf jene Ideale, die oft heftig verteidigt wurden und die Mitglieder der Gruppen auch noch nach deren Auflösung begleiten.
Obgleich es scheinen mag, dass Widerstand in der heutigen Zeit eine notwendige Bedingung für Gruppenbildung sei, muss dem nicht zwangsläufig so sein. Kollektive entstehen ständig allein aus einer kollektiven Sensibilität heraus. Diese muss nicht auf eine schlichte Anti-Haltung reduziert werden, sondern darf vielmehr als eine spezifische Weise verstanden werden, die Welt zu sehen, zu hören, zu begreifen und zu empfinden. Diese Sensibilität, für die kein Name ausreicht, zeigt sich eindrucksvoll in den wandernden Figuren von Geister und ihren Welten. Welten, die bewegend offen und verschlossen zugleich sind; der betrachtende Mensch zieht vorüber an einer Konstellation von Gestalten, Objekten, Wesen und Elementen, die bereits ein Leben führten, ehe es Augen gab, die sie sahen, und Ohren, die sie hörten.
Die kollektive Form kann Trägerin einer Weise sein, ein Verständnis der Welt zu bewahren und zu kultivieren. Sie als etwas Kostbares wahrzunehmen, das es wert ist, erlebt zu werden, und nicht auf dem Weg zu einem Ziel achtlos zertreten wird. Dieses Bild, dieser Klang, dieses Objekt, genau so platziert; die Sprechweise eines Lernenden, das Ausweichen eines Menschen mit gebrochenem Herzen, die Haltung eines Pfaus. In diesen Momenten ist das Gesehene und Gehörte sich selbst genug; es ist notwendig. Die Liebe zu Bild und Klang auszukosten, alles zu sehen, oder die Aufrichtigkeit eines gebrochenen Blickes preiszugeben, eine Entscheidung, über die nachzudenken sich nicht lohnt.
Živá Voda
Die Filme von Sandra Makhlouf konzentrieren sich auf die Zerbrechlichkeit jener Momente, die allein oder in Gesellschaft verbracht werden, und sind feinfühlig gegenüber der Notwendigkeit, jede Sekunde wahrzunehmen, ob sie nun verloren oder genutzt ist. Die Entschiedenheit ihrer Filmwelt macht dabei Platz für die Fragilität ihrer Figuren, die sich ständig bewegen, jedoch ohne klares Ziel; ihre Bewegungen sind Momente des Versuches, Raum einzunehmen, von ihm zurückzutreten oder ihn erneut zu erfühlen. Auf diese Weise lädt Makhlouf ihre Figuren ein, sich im Raum zu versammeln und ihn sowohl im Vorder- als auch Hintergrund nicht intellektuell zu verstehen, sondern ihn fühlend zu erkunden. Die Prozesse vollziehen sich im Inneren der Figuren und offenbaren sich in Gesichtern, Räumen und allem, was dazwischen liegt.
In „Živá Voda“ wird das wahrnehmende Subjekt zunächst von den Klängen eines Liedes empfangen, dann erscheint ein kleines Mädchen und tanzt dazu. „I love the sea, tender as you are, and at times, like you, crazy, migrating, travelling, and at times, like you, confused, and at times, like you, angry, at times full of silence. I love the sea.“ Indem Makhlouf die Kamera fest positioniert, erlaubt sie dem Tanz, gesehen, und dem Lied, gehört zu werden. Ihre Verbindung verstärkt beide Elemente. Die Komplexität des Liedes wird instinktiv, körperlich, vom Mädchen verstanden, das stets nur tanzt und sich bewegt. Das Lied ist einfach nur ein Lied und verdient es, gehört zu werden.
Diese Verstärkung des Körperlichen ist auch in der neueren Medientheorie und Kognitionswissenschaft sichtbar. In der Filmtheorie geschieht dies oft durch eine reduzierte Kameraführung, die Personen mit einer nah geführten, fokussierten Handkamera begleitet. Der Fokus dieser figurativen Logik liegt auf dem Körper als Urheber und zugleich Opfer, die verfolgte Person ist Ursache und Wirkung zugleich. Makhloufs Kamera folgt hingegen ihrem Weg nicht mittels quasi subjektiver Bewegung einer hyperaktiven Kamera, sondern durch die Ruhe einer Motivation, Zeuge zu sein und schlicht Raum für ein betrachtendes und lauschendes Subjekt zu schaffen. Die Perspektive erfasst den Körper des kleinen Mädchens, gekleidet in Gelb und Weiß, zu ihrer Linken ein Tisch mit einer weißen Tischdecke, im Hintergrund weiße Vorhänge. Begleitet wird die Szene von Partylichtern, die von links nach rechts an- und ausgehen.
„Živá Voda“ gibt Anlass zum Verweilen, und durch die Fixierung der Kamera auf diesen anfänglichen Tanz offenbart sich die figurative Logik darin, der Choreografie des Moments zuzusehen, in sanfter Weise Tanzbewegungen und Lied in Einklang und Konflikt treten zu lassen. Perfektion der Bewegungen ist keine Notwendigkeit; dass überhaupt getanzt wird, mit leichter Aufmerksamkeit auf die Choreografie, ist ihre Daseinsberechtigung. Indem die Kamera an diesem Punkt verbleibt, die Figur vollständig vom Kopf bis zu den Füßen einrahmend, näher am Boden als weiter entfernt, führt Makhlouf eine junge Frau ein, die durch ein Fenster von rechts nach links in eine Lobby tritt. Der Ton ist gedämpft, das Gespräch mit der Empfangsperson bleibt unhörbar. Im Fokus steht nicht der Inhalt, sondern die Form des Rahmens, Ausdruck einer Neigung, Körper in Räumen in Aktion zu sehen.
„It’s fine like this?“ Die fragende Stimme ist nicht sichtbar. In einer Umkehrung der vorigen Szene ist nun das Gespräch hörbar, doch der Gesprächspartner bleibt unsichtbar, die Stimme kommt von außerhalb des profilmischen Raums. Eine Person sitzt vor der Kamera, antwortet knapp auf die Fragen, während die Stimme spricht und spricht und spricht. „The children don’t speak any Slovak, nor does the father. Still, they have a good life there.“ Die Worte fliegen vorbei. Die Figur verlässt den Raum. „What are you doing there?“ „Living.“ Ein violett-bläulicher, entsättigter Ton kontrastiert mit Augen, Lippen, Haaren der Figur, einem blauen Stuhl, einer Steckdose. „Goodbye.“ Oft werden die gezeigten Figuren angesprochen, nicht aber mit ihnen gesprochen, unfähig, Verbindungen im Gespräch zu schaffen, die eines Dialogs im Kleist’schen Sinne würdig wären.
Die Figur bleibt in Bewegung, wird jedoch oft auch im Moment, in der Stille gesehen. In einem Augenblick klarer Einsicht in die Zeit steht die Figur in einem Park, und die Sonne begleitet sie, nur in ihrer Wirkung sichtbar. Sie bewegt sich, und auch die Schatten der Gebäude wandern. Die hier verstandene Präsenz darf nicht unterschätzt werden, sie ist erkämpft durch verbrachte Zeit, eine Notwendigkeit, die Makhlouf klar erkennt, bis die Figur plötzlich verschwindet und so der Legende der heißen Quelle Glaubwürdigkeit verleiht, in der eine Frau, „lonely and separated, wished but nothing but to be transformed back into the swan. She entered the water again, but this time forever disappearing into the steam.“
Le Tandem
Eine Person singt und bemerkt, dass jemand anderes nicht mitsingen möchte. „That’s not fair.“ „You don’t like the song?“ „I do. But I prefer to listen. You have a nice voice.“ Beide unterhalten sich nun in einem einzigen Bild, nachdem zuvor nur die singende Person zu sehen war. Die eine schaut aufmerksam zu, achtet auf jedes gesprochene Wort. Die andere, eine Sprachlernende, blickt anderswohin, eine Geste, die jeder kennt, der versucht, die richtigen Wörter für einfache Gedanken zu finden. Und dennoch ist diese Sprachlernende fähig zu verstehen, dass die Menschen, die Italienisch sprechen, sentimental werden. Eine Sprache zu verstehen heißt nicht nur, die Worte zu verstehen, sondern auch ihren Tonfall zu erfassen, selbst ohne die Details des Gesagten vollständig zu begreifen. Zwei Menschen sprechen miteinander, die eine kann ein Thema etwas hartnäckiger ansprechen, ohne dass die andere gekränkt wird, weil in der Art und Weise, wie die Worte gesprochen werden, Fürsorge liegt.
Manchmal ist Sprache gar nicht notwendig, manchmal reicht eine Bewegung, ein Lauf in eine bestimmte Richtung, um einem anderen Menschen ein Signal zu geben. Manchmal braucht es für diese Bewegung nicht einmal eine andere Motivation als die bloße Aktion selbst. Zu anderen Zeiten jedoch entstehen Missverständnisse, und Verbindungspunkte lassen sich nicht herstellen. „Were the pirates here?“, fragt eine Person die andere, nachdem sie etwas wiedergefunden hat, das verloren war. „Au Revoir.“ Die Worte könnten falsch ausgesprochen oder missverstanden worden sein, und allein dies genügte, damit die Person sich entfernte. Doch Begegnungen finden ständig statt, wenn man nur hinschaut. Der Anblick einer Straßenbahn, ein laufender Mensch, solche glücklichen Zufälle treten ebenso regelmäßig auf wie Missverständnisse. Im Ringen um Verständigung liegt vielleicht Hoffnung, selbst wenn diese manchmal weit entfernt scheint.
Doch diese Gesten kommen nicht ohne Vorboten aus. Eine Person sang, und die Notwendigkeit des Singens betrifft nicht nur die oberflächliche Natur des Ausdrucks als Kanal emotionaler Befreiung; das Persönliche, nach außen gewandt, tritt oft als folgenloses Ereignis auf, das über die Grenzen des eigentlichen Aktes hinausgeht. Für Makhlouf, die sensibel gegenüber den Bewegungen des Verweilens ist und die Höhepunkte erzählerischer Verpflichtung elegant umgeht, jene verborgenen Räume, in denen jeder Atemzug seine Würde zurückzuerlangen scheint, wird der Zugang zum Singen zur Gelegenheit: zu beobachten und beobachtet zu werden. Melodien entfalten sich innerhalb der Grenzen eines Zimmers. Das Intervall, in dem ein Lied Befreiung von den Zwängen der Sprache bietet. In „Le Tandem“ umkreisen die Figuren einander, beim Laufen, Singen, Finden, Übersehen und Scheitern im Ausdruck. Richtungen ändern sich, angetrieben von jener Kraft, die zu Beginn freigesetzt wurde. Der Verlust eines kleinen Gegenstands garantiert nicht seine Rückkehr, und selbst dann: das Versprechen einer gelungenen Interaktion steht in Wasser geschrieben. Indem sie auf Distanz bleibt und ihren Figuren die schlichte Anmut eines Atemzugs, eines Blickes gewährt, verfolgt Makhloufs Kamera ihre Bewegungen und Schicksale, während sie miteinander kollidieren und vorsichtig ihren Weg zu einem Ende finden.
Together
William Wrubels „Together“ bewegt sich zielsicher durch sein Terrain, nicht um es zu präsentieren oder zu konstruieren, sondern um die Schritte zu zeigen, den Prozess von etwas, das weder zum letzten noch zum ersten Mal geschieht. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Werk Luft benötigt wird, dann deshalb, weil die Figuren angestrengt darum ringen, zu Atem zu kommen, ihre Worte hervorzubringen. Beide Figuren blicken einander an, als sähen sie aneinander vorbei, hin zu etwas, das über das hinausgeht, was sie offenbaren wollen. Die beklemmende Entscheidung liegt darin, ihren leer in die Ferne gerichteten Blick zu ignorieren und dennoch fortzufahren, sie begehen zwar keinen Akt, der zu den schlimmsten der Menschheitsgeschichte zählt, doch es ist offenkundig, dass etwas im Gange ist.
Wenn das Zuschauen in Wrubels Film zum zentralen Modus des Handelns wird, dann nicht bloß, um ins Metaphysische abzugleiten, in jene Nacht, in der alle Kühe grau sind, sondern um die Bewegungen eines anderen Menschen zu verstehen, sein Lachen, seine Art zu essen. Dabei könnte durchaus ein Hauch persönlicher Geschichte hörbar werden; etwas könnte sich als Schlüssel präsentieren, der die strukturelle Geschlossenheit der anderen Person öffnet. Die List des gegenseitigen Kennenlernens entfaltet sich in einer lässigen Befragung, in der Einstellungen, Tonfälle und Blicke bedeutungsvoller sind als der konkrete Inhalt des Gesagten. Wenn die Protagonisten, die in einer warmen Wohnung auf einen geplanten Dreier warten, durch ebendieses Warten definiert sind, so ist dessen unvermeidliches Ende der Moment, der ihre elementaren Rollen aufbricht.
So endet der Film. „At this point we’d just be repeating ourselves“, sagt die weibliche Figur zu Beginn des Films. Genau dieser Wiederholung versucht man zu entkommen. Doch die Imagination ist stark, während die Vernunft schwach und dürftig bleibt. Wer immer aus diesem Tanz der Ewigkeit austritt, wird dadurch nicht zwangsläufig von seinen Fehlern freigesprochen; zugleich ist das Aufgeben nicht notwendigerweise ein Akt der Erlösung. Die beiden Figuren sitzen, stehen, rauchen, essen, schlafen. Sentimentalität ist verbannt, Bilder und Klänge stimmen sich auf die Melodie einer Präsenz ein, die bewahrt bleibt, trotz der Stadt, trotz des hitzigen Gelbs, das es dennoch schafft, das Grün der Bäume, der Büsche und des Hintergrunds hervorzuheben. Die Farben wirken schlicht, still, gezielt auf spezifische chromatische Texturen abzielend, das Gesicht eines Menschen, ein schlichtes T-Shirt, Jean Dutourds „The Horrors of Love“.
Doch wenn diese Figuren ihren Raum teilen, stellt sich die Frage, warum sie sich dem überhaupt aussetzen. Vielleicht deshalb, weil Anerkennung ein Gegenüber verlangt; das subjektive Sich-Auflösen ist umso präsenter in jenen Momenten, in denen die Möglichkeit einer anderen Entität, deren Schatten entweder umgangen oder angenommen werden müssen, in der Schwebe gehalten wird. „Together“ zeigt diese romantische Unmöglichkeit, indem es zwei Figuren (und weitere, einige implizit, andere mit Gesicht) in eine Wohnung versetzt, begleitet von einer großzügigen Sonne, deren Übermaß die Figuren in Schach hält, während die Verhandlungen über ihren bevorstehenden Dreier ins Kreisförmige verlaufen. Indem Wrubel die Spirale des Neurotischen mit subtiler Sicherheit durchdringt, erfasst er klug das Terrain seiner Figuren als eines, in dem Distanzierung keine Bedingung der Sprache, sondern deren grundlegender Zustand ist. Die Aufrichtigkeit des Blicks führt hier aufrichtig ins Scheitern. Die Textur des Films lädt ein, ohne anzubiedern, vergießt Tränen, ohne dabei zu verweilen. Dieser Pfad isoliert, um letztlich zu verbinden. Und so verschwindet die Sonne, um wiederzukehren, um etwas explizit, schmerzhaft offensichtlich zu machen: unerledigte Angelegenheiten, die nicht vom Fleisch aufgelöst werden, sind von diesem verdammt.
Vielleicht ist nichts schmerzlicher klar, als wenn eine Kamera langsam nach oben schwenkt, blickt und verweilt, und ein gelbes T-Shirt dabei beobachtet, wie es einen Körper verlässt und im Blau verschwindet.
Rio
Filmische Welten bedienen sich unterschiedlicher Techniken der Konstruktion. Die Karte ist nicht das Gebiet, und der Plan verändert sich während der Schritte hin zur Konzeption vielfach. Der wahrnehmbare Endpunkt dieser Entwicklung wird auf der Leinwand gezeigt, doch die innere Welt des wahrnehmenden Subjekts macht die Verarbeitung eines Films zu einer höchst persönlichen Angelegenheit. Einzelheiten können nur gelegentlich gesehen oder gehört werden. Es lässt sich nicht verleugnen, dass der sogenannte Cinephile ein Solipsist bleibt, der, selbst im Zeitalter der zwanghaften Selbstdarstellung auf sozialen Medien, meist nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, das auszudrücken, was nach dem Sehen eines Films verbleibt. Die Konstruktion der filmischen Welt bleibt deshalb ein Vorgang, der nur selten durch ein Verständnis seines Endpunkts erschlossen wird. Die Vermittlungskette wird zu lang, um noch klar bestimmen zu können, wo alles beginnt und endet.
Gerade deshalb gewinnt die emotionale Resonanz zwischen zwei oder mehr spezifischen Akteuren, der Regie und dem wahrnehmenden Subjekt beim Zuschauen an Bedeutung. Es entsteht eine Verbindung, die durch und dank des filmischen Objekts geschaffen wird. Bislang lag der Akzent auf dem Emotionalen, doch es gibt auch einen echten Gewinn darin, die komplette Erfahrung der filmischen Reise über das Sinnliche zu verstehen. Denn so lässt sich die Welt im Film auf faszinierende Weise erschließen: nicht bloß als Narrativ, sondern als Aushandlung mit den Sinnen. Die Sinnlichkeit ist dabei nicht weit von dem Punkt entfernt, an dem das Licht hervortritt, der Klang widerhallt und Berührungen mit einer Intensität fühlbar werden, die durch spezifische Organisationen, Konstrukte und Entwürfe ermöglicht wird. Vorstellungen davon, wie Dinge gefühlt, anstatt direkt verstanden werden, sind selten, weil schlicht und grob formuliert. Dies ist in der Tat eine Armut, die sich nur durch die Konzentration auf das bereichern lässt, was nicht einfach in Worte zu fassen ist, sondern unausgesprochen bleibt, offen und bereit zur Interpretation.
Marlon Webers ästhetische Entscheidungen sind die einer Künstlerin, die sich für das Unausgesprochene interessiert, nicht weil es der Raum von Angst, Missverständnis oder einfacher Entfremdung ist. Ihr Interesse liegt vielmehr in der starken auratischen Qualität ihrer Figuren. Ihre Symmetrie offenbart ein Verständnis der Körper als etwas, das größer ist als sie selbst. Ein melancholischer Blick nach draußen aus dem Auto während eines Gesprächs vermag über Melancholie als gelebte Erfahrung mehr auszudrücken als jeder wortreiche Monolog. Weber verwendet, ähnlich wie die anderen Mitglieder des Kollektivs, Einfachheit als ein Modus vivendi. Nie wird eine solche Erfahrung zugunsten billiger Effekte verraten, stets bleibt ein Vakuum, in das die Betrachtenden ihre eigenen Vorstellungen einbringen.
Die Analyse des Blicks ist eine stetige Cathexis der Filmkritik und Filmtheorie. Je nach bevorzugter Theorie besitzt der Blick die Macht, Machtverhältnisse, Sexismus, Homoerotik, Fixierung oder Verführung sichtbar zu machen. Als Objekt einer formalistischen Analyse muss jedoch jede Untersuchung des Blicks beim blickenden Subjekt beginnen; und um ein Subjekt zu haben, muss es eine Person geben, dargestellt oder impliziert, innerhalb des Sichtfeldes. Selbst wenn keine Person dargestellt wird, bleibt das Kamera-Subjekt, der Blick der Regie, der darauf abzielt, bestimmte Bildausschnitte auszuwählen. Die Ebenen der Analyse vervielfachen sich je nach Toleranz für Meta-Schichten.
Moderne Entwicklungen in der Montage fordern jedoch, dass sich die formale Analyse des blickenden Subjekts auf Subjekte und Objekte auf der Leinwand bezieht. In „Rio“, Marlon Webers erstem Kurzfilm, ist die zentrale Prämisse nicht der Blick an sich, obwohl er eine tragende Säule des Inhalts darstellt, sondern vielmehr ein Medium, durch das sich Figuren zueinander und zu ihrer Umwelt in Beziehung setzen. Die Einfachheit der Ausführung entwickelt die Komplexität der blickenden Subjekte bei Weber so stark, dass es verlockend erscheint, von einem geometrischen Verständnis der Personen und ihrer Umgebung zu sprechen. Das erste Bild zeigt Zweige vor einem dunklen, violett-bläulichen Himmel; das zweite Bild eine Person, die etwas in ein Papier zus3Analyseebenen: Es ist sinnlos zu versuchen, das Objekt in der Szene zu erahnen, denn wenn der Blick des Regisseurs gewollt hätte, dass das wahrnehmende Subjekt bemerkt, was es ist, hätte er es getan. Das Objekt ist einfach da, weil es da sein muss.ammen mit einem Brief legt. Eine Gestalt blickt ins Feuer, eine andere spricht. Ihre Worte sind jedoch nicht zu sehen, während sie gesprochen werden.
Menschen steigen in Autos, hängen etwas an eine Pinnwand. Die Alltäglichkeit des Lebens und die automatische Art, wie Menschen Dinge erledigen, sind genauso bedeutungsvoll wie Nah- und Halbnahaufnahmen von Personen, die schauen und berühren. Doch das Wunder von „Rio“ liegt darin, wie sich im Verlauf des Films verändert, wer schaut und warum. Es beginnt mit einem Fluss und einem Hund, wobei der Hund in einem anderen Tempo mit seiner Umwelt interagiert als die Menschen. So sehr, dass, als im nächsten Bild zwei menschliche Gestalten mit dem Fluss interagieren, ein Vergleichspunkt zum Hund entsteht. Hier bewegt sich Webers Kamera hin zum Wasser und zur Natur. Etwas hat sich verändert; die beginnende Erkenntnis zerstört den geheimen Pakt zwischen allen Beteiligten nicht, sondern schafft stattdessen ein Ritual der Komplizenschaft, etwas, das vielleicht nur Tiere verstehen können.
Dos amigos vuelven a casa solos de noche
Die zärtliche Unaufdringlichkeit von „Rio“ setzt sich in „Dos amigos vuelven a casa solos de noche“ fort, einem Kurzfilm, der ähnliche Beschäftigungen mit dem Blick aufweist, aber zusätzlich die Sinnlichkeit körperlichen Begehrens ins Spiel bringt. Der Tanz, den Weber kreiert, stützt sich erneut auf das Unausgesprochene, doch ihre Figuren in „Dos amigos“ bewegen sich und täuschen Interesse vor wie einstige Liebende. Deutlich wird hier eine Bewegung hin zu einer thematischen Untermalung, welche das Interesse am Blick mit einer klaren Absicht verbindet. Jede wahrgenommene Passivität ist nichts anderes als die geistige Aneignung des Ziels, über das nicht gesprochen, sondern das nur körperlich ausgedrückt werden kann. Begehren wird zu etwas, in das sich die Menschen verwandeln, und nicht ein Thema, das sie rezitieren. „The city bores me.“ „Where else could we go?“ Die Antwort liegt auf der Hand.
Lindo, precioso. Die Stadt, die Pflanzen, der Biologiestudent? Weit davon entfernt, das Begehren unter den Mantel der Unterdrückung zu zwängen oder ihre Charaktere mittels ihrer Beziehung zu Blut und Körper zu psychopathologisieren, entscheidet sich „Dos amigos“ für die Opulenz der Sinnlichkeit, die sich in Strategie und Handlung äußert. Das Wesentliche bleibt erhalten, die sinnliche Fragmentierung wird gestreift, gekratzt und erblickt, subtil die Blicke des Begehrens einfangend, das perfekt platzierte, weil notwendige Wort, das Fleisch des Nackens. Wie bereits in „Rio“ begleitet Webers Kamera ihre Subjekte, um sie dann loszulassen, den Körper als Raum und den Raum als Körper segmentierend, und so formale Reichhaltigkeit in Momenten sorgfältig gesetzter Aktion und Konsequenz katalysierend. Blut ist unvermeidlich, doch die Freude an der Jagd ist lediglich ein Nebeneffekt der Anerkennung dessen, was Schönheit ausstrahlt. Teil der Körperökonomie, seiner Rhythmen, seiner Haare. Das Vorher und Nachher kreisen um die Aktion, und so führt der figurative Tanz des Films zurück zum Anfang: zu einer leblosen, ausgestreckten Hand. „Está rebueno“ skizziert den Kreislauf der sexuellen Politik in der Stadt als endlos, Sinnlichkeit wird ewig. Vampirismus.
Die Geräusche der Stadt setzen sich fort, die Klänge der Pflanzen greifen ein, aber erst das Geräusch des Begehrens und der ihm folgenden blutigen Lippen überführt das Nachdenken in Aktion. Webers Selbstsicherheit lässt verschiedene Elemente aufeinanderprallen, um eine Sinnlichkeit zu erzeugen, die gefühlt wird, erlebt von Körpern, deren Kollision erst in den nachfolgenden Wirkungen sichtbar wird. Es gibt kein Pathos, da dieses zugunsten der Betrachtung eines Willens evakuiert wurde, der den Körper berührt, zerstört, aussaugt und ihn zu seinem endgültigen Ende trägt. Die Stadt ist weit und reichhaltig. Hier erliegen die Körper der Notwendigkeit nach Mehr, selbst wenn es längst genug ist, und dies ist die ewige Figur, welche die beiden Freunde Tag für Tag spielen, um sich zu ernähren. Es kann nie genug sein.
Wenn Kollektive einen bestimmten Aspekt der Welt wertschätzen können, vermögen sie einen Akt des Widerstands darzubieten, der nicht bloße Zerstörung ist, keinen Hass, der alles zu untergraben sucht, ohne die Mühen des Erschaffens zu verstehen, die mit einem solchen Akt einhergehen. Einem Gebilde wie einem Kollektiv jedoch von außen Aufgaben zuzuschreiben, verdammt es zwangsläufig zum Scheitern. Die Filme von Geister haben keinen anderen Zweck, als einfach zu existieren; ihre persönlichen und formalen Verpflichtungen sind Wege, bestimmte Anliegen, Obsessionen, Leidenschaften und Probleme zu ordnen, vor allem jedoch, diesen Anliegen eine angemessene, gerechte Form zu verleihen, die ihnen entspricht. Diese Suche nach Angemessenheit, diese Liebe, macht das Filmemachen zu einer Arbeit, die sich vom Denken, Schreiben, Sprechen oder Gehen unterscheidet, und wenn diese Angemessenheit gefunden wird, dann existiert sie schlichtweg: notwendig und wahr, wie Blätter im Wind.
Notes
- 1Wittgenstein 4.1212. Tractatus Logicus Philosophicus.
- 2Diese Unterscheidung gilt nur insofern, als dass man damit ausschließt, dass es sich bei Digitalkameras auch um Chemikalien handelt, was aber die Traditionalisten des Films beruhigt.
- 3Analyseebenen: Es ist sinnlos zu versuchen, das Objekt in der Szene zu erahnen, denn wenn der Blick des Regisseurs gewollt hätte, dass das wahrnehmende Subjekt bemerkt, was es ist, hätte er es getan. Das Objekt ist einfach da, weil es da sein muss.