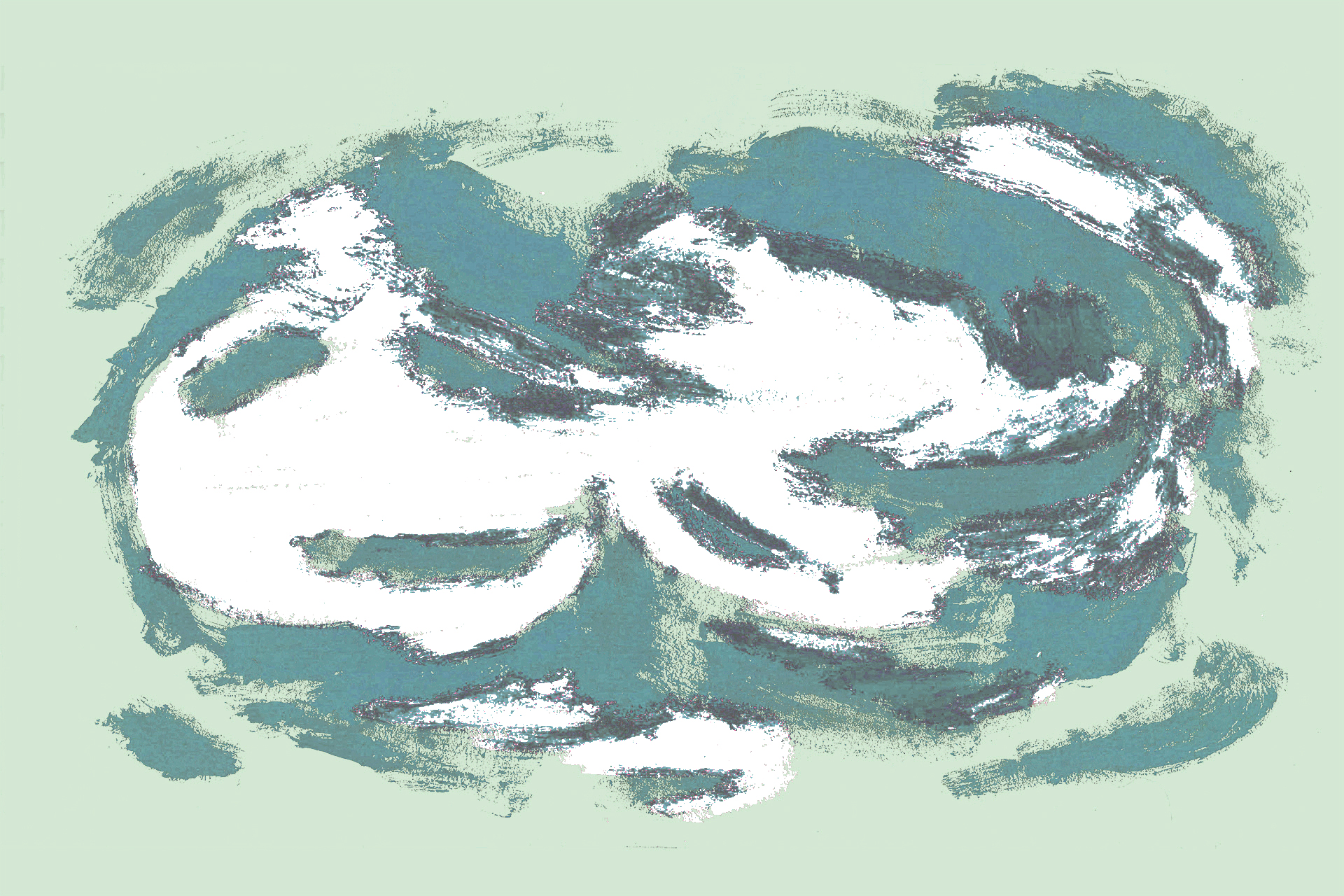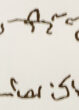Schallendes Licht: Die Filme von Luise Donschen
Der Wunsch zu wissen ist mehr als das halbe Wissen; man bekommt dadurch das Gefühl des Gegenstandes, den man erfahren will, seine Form, die sich fast anfassen lässt. Jedoch ist der Tastsinn nur eins der geeigneten Mittel, die Welt zu begreifen. Die Wahrnehmung des Gegebenen, die in seiner geschicktesten Form zur Arbeit der Phänomenologie gehört und oft der Einstieg in die Welt des Philosophischen ist, ist tatsächlich oft beinahe unmittelbar, oder so scheint es auch, wenn selbstverständliche Aktionen im Alltag durchgeführt werden: Augen aufmachen, aufstehen, gehen. Die Verfahren eines Morgens verbrauchen Zeit und Energie. Dass sie natürliche Handlungen sind, bedeutet aber nicht, dass sie tief in das Sein des Körpers programmiert werden, sondern dass die Prozesse nicht bewusst eingesetzt werden müssen, als wären sie aufwandslos. Sie sind üblich durchgeführte Aktionen, die sich im sozialen Austausch als natürlich konkretisiert haben. Natürlichkeit steckt dann in der Mischung zwischen biologischer Gewohnheit und sozialer Konstruiertheit. Letztere wird als Fehler oder Erfolg der Sprache betrachtet, je nach präferierter Weltanschauung.
Trauriger wird es jedoch -nicht nur im Leben, sondern auch im Film-, wenn sich Gedanken zur Wahrnehmung gen Wiederholungen richten. Bestimmte Gegenstände wieder erfahrbar zu machen, als wäre es das erste Mal, dass ein Subjekt sie erfährt (und je nach der Philosophie, sei es mit Althusser oder Badiou, wird es überhaupt als Subjekt konstituiert), gilt spätestens seit Madonna1 „Like a Virgin“ (1984) als eine öffentliche Besessenheit, deren Auswirkungen eine Reise auf der Suche der ersten Wahrnehmung verursacht, vorausgesetzt, diese sei vergnüglich. Andernfalls wird die Obsession zum Thema des Analystencouchs, die spätestens seit Lacan im eigenen Haus ödipal bleibt2“Zurück zu Freud!” oder Dervin, D. (1997). Where Freud was, there Lacan shall be: Lacan and the fate of transference. American Imago, 54(4), 347-375.. Etwas, das zum ersten Mal wahrgenommen wird, besteht darauf, trotz des Eingreifens von Expert*innen, obsessiver Mad-Scientists und Psycho-Superheld*innen, einzigartig zu sein. Es bleibt unberührbar, nicht modifizierbar. Als hätte ein besonders hartnäckiger Steuerberater das Wahrgenommene in unknackbaren Stein gemeißelt, oder zumindest in eine AES 256-Bit-Verschlüsselung.
Die Rückkehr zum Ursprung erweist sich als schwieriger als erwartet, da das zum Konsument gewordene Subjekt im Kapitalismus mit dem Alten sich nicht zufrieden gibt. Das Bedürfnis fürs Neue wird vom System ausgenutzt3McGowan, T. (2016). Capitalism and desire: The psychic cost of free markets. Columbia University Press., wodurch es zu einem ständigen Bombardement der Sinne kommt; algorithmische Medien arbeiten die ganze Zeit, um den Zeitraum nach dem Verbrauch eines Handys zu berechnen und vorherzusagen. Es findet eine „Verlagerung von einer vergangenheitsorientierten Aufzeichnungsplattform zu einer datengesteuerten Antizipation der Zukunft“ statt4Hansen, M. B. (2015). Feed-forward: On the future of twenty-first-century media. University of Chicago Press. p.4.. Das Kino verliert gesamtgesellschaftliches Interesse. Was einmal eine Vision der Zukunft bedeutete, wird zum Altmodischen. Haptische Medien bedeuten andererseits Zugang und Einstieg in das Neue. Ein vom Cyberpunk geerbter Traum der Gleichzeitigkeit, die langsam wahr geworden ist und trotzdem nicht wie gedacht. Die Möglichkeit steckt aber trotzdem darin, etwas anderes zu gestalten, da Medien nicht sterben, sondern verharren im gegenseitigen Austausch. Film ist unter einer gewissen Hinsicht, nämlich die des reinen chronologischen Vergleichs, ein junges Medium, das noch wächst und noch wachsen kann.
In jedem Fall fühlt sich die wahrgenommene Zeit oft an, als wären Jahre vergangen, obwohl es doch nur eine Woche war. Zeitverzerrung ist ein Nebeneffekt der gegenwärtigen Lage, die auch sprachliche Konsequenzen hat. “Das war der beste Film, den ich je gesehen habe” könnte, obwohl trivial, zum Alptraumsatz der analytischen Philosophie werden. “Der Film hat mein Leben verändert” bringt noch mehr Fragen als Antworten, obwohl die*der Sprecher*in nur etwas Wichtiges ausdrücken wollte. Da gibt es keinen Bedarf für eine Analyse. Ein Mensch hat den Satz geschrieben oder gesagt, wurde wohl zu Tränen gerührt, hatte eine schöne Erfahrung mit einem Film und will der Welt davon erzählen. Obwohl die Online-Filmwelt der “New Cinephilia5Shambu, G. (2020). The new cinephilia. caboose.” oft auf solche Äußerungen reagiert, oft negativ, gibt es nichts falsches daran, den eigenen Enthusiasmus zu äußern. Und doch: wenn man keine in patriarchalen Verhältnissen aufgewachsene Person ist, besteht die Möglichkeit immer, zum Hassobjekt zu werden, wenn die Meinungen nicht passen. Plötzlich ist die Erfahrung nicht mehr eine eigene, sie ist jetzt Teil des sozialen Feldes. Hegels gebrochene Schönheit wird zum Übergang des absoluten Geistes6Arndt, A., Kruck, G., & Zovko, J. (Eds.). (2014). Gebrochene Schönheit: Hegels Ästhetik-Kontexte und Rezeptionen (Vol. 4). Walter de Gruyter GmbH & Co KG., aber das soziale Unterfangen, was dieser umfasst, erscheint wie ein falsches, trügerisches Bild.
Noch eine Äußerung, diesmal von Seiten der Filmemacher*innen und Akademiker*innen, die sich oft von der Belastung einer Kommentarsektion entfernen, fällt oft in Gesprächen zu neuen Filmen “Ein Film fühlt sich an, als sähe man “Film” überhaupt zum ersten Mal”. Gemeint wird, dass die Energie des Anfangs des Kinos gespürt werden kann. Was am Beginn wie eine aufgehobene Version der oben erwähnten, noch üblicheren Sätze aussieht, ist ein Versuch, außerhalb der eigenen persönlichen Geschichte hinauszugehen und sich in der Historie des Kinos nochmal zu befinden. Das Kino als historisches Objekt zu betrachten sollte keine Beleidigung gegen die individuelle Erfahrung sein, die Herangehensweise hat aber durchaus schöne Nebeneffekte, welche einen einzigen Film wie noch nie öffnen können. Am Anfang waren das Bild und der Ton. In den Filmen von Alice Guy-Blaché, Griffith und Dorothy Davenport strahlen diverse Qualitäten aus. Spürbarer ist aber die Erfahrung und die Aufregung, etwas zu sehen. Ein Bild davon zu haben. Und dann auch Ton. Die Beschreibung dieser Elemente hat einen fast metaphysischen Klang, aber nur einen Klang, denn dass diese Eigenschaften schwer in Worte zu fassen sind, bedeutet nicht, dass sie nicht aus dem Material, aus dem, was gedreht wird, emanieren.
Die*der Sprecher*in sah einen Film, der zurück zum Ursprung pendelt und dennoch hier und jetzt läuft. Luise Donschens filmische Arbeiten finden, wenn sie doch gefunden werden, in der Jetztzeit statt. Sie wurden zwischen 2017 und 2021 produziert und waren auf zahlreichen Festivals zu sehen. Ihre Zeitmaschinenqualität spricht nicht nur für die Fähigkeiten der Filmemacherin, mit dem profilmischen Raum zu arbeiten, sondern für die versteckte Qualität des Kinos, Potenziale/al gänzlich zu entfalten. Innerhalb jener filmischen Gefüge steckt Spielraum, ein entscheidender Schnitt, ein nicht gesehener Teil des Körpers, ein Lied, dessen Melodie anders getanzt werden kann. Donschens filmisches Schaffen arbeitet mit figurativen Ähnlichkeiten, einem immer im Werden begriffenen Prozess der Mimesis, der sich Vergleiche und Hypothesen zu eigen macht. In ihren Filmen werden potenziell klinische Herangehensweisen zu sinnlichen, da das Hypothese-Testen nicht nur der Bereich der Wissenschaftler*innen ist, sondern auch der Metaphysiker*innnen, die sich mit Entitäten beschäftigen, Phenomena, die sich beschreiben lassen. Jedoch geht es in Filmen nicht nur um das Beschreiben, sondern auch um das Zeigen. In dieser Tension arbeitet Donschen, den Unterschied zwischen beiden vermischend. Das Probieren ist sinnlich, Mimesis und Vergleich sind aber bloße Effekte der Montage, die Elemente durcheinander wirft. In Momenten heiliger Verkettung werden sie weiter erforscht und ausgearbeitet.
Rudolf Otto (1869-1937) versteht das Heilige als eine „numinose“, nicht-rationale Realität, ein mysterium tremendum, das sowohl Furcht und Faszination in den Menschen hervorruft, die mit ihm in Berührung kommen. Seine Begrifflichkeiten betonen die Eigenschaft des Irreduziblen, bei dem andere Kategorien ungültig sind. Die Ich-Perspektive ist entscheidend, das Heilige übersteigt jeden Versuch, es einzudämmen7„Holiness“ von Robert MacSwain in Goetz, S., & Taliaferro, C. (Eds.). (2022). The encyclopedia of philosophy of religion. Wiley Blackwell.. Jedoch hat in der Arbeit Donschens die Montage eine Reihenfolge, man kann sie betrachten, studieren, fast anfassen, wenn es sich um analogen Film handelt. Die heilige Verkettung ist dann kein Mysterium, sondern Material, in dem sich Form und Materie wiederfinden. Der menschliche Körper wird zum Tier, das Tier wird zum Anthropomorph. Das Entscheidende besteht darin, herauszufinden, zusammen mit den Figuren, was ihre besonderen, einzigartigen Dynamiken sind. Die Darstellung betrifft die Oberfläche; Donschens Technik ist ein Traversalschnitt. Licht, Körper, Figuren und Einstellungen sickern durch, die Regisseurin verleiht ihrer nahtlosen Konstruktion eine Würde. Jeder Schnitt brennt, jedes Risiko offenbart sich neu im Körper.
Der Verführer in Casanovagen
Die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis durchdringt hartnäckig jedes politische, philosophische und akademische Weltverständnis, und das nicht ohne Grund, als ob es nur auf die Handlungen ankäme und die Theorie, auf der sie beruhen, irrelevant wäre.Politische Interessengruppen reden üblicherweise aneinander vorbei, da sie darauf bestehen, endlose Diskussionen zu führen, bis jemand auftaucht und verkündet, dass das eigentliche Thema, denn es geht immer um einen bestimmten Punkt, verloren gegangen ist. “Es kommt drauf an, die Welt zu verändern” ist in der Sprache der an politischem Wandel Interessierten ein Aufruf zum Handeln, der oft für diese Art des Aufräumens steht. Wenn man sich die Welt anschaut, scheint die Forderung selbstverständlich zu sein. Doch was genau tut diese Aussage, wenn sie auftaucht, um das von ihr gewünschte Ziel zu verwirklichen? Ohne Theorie gibt es zielloses, spontanes Verhalten, das der „Sache“ meist eher schadet als hilft; ohne Praxis gibt es das endlose Reden, das ewige Plenum, in dem sich die meisten Körper ab einem bestimmten Punkt den Tod wünschen, statt noch ein Wort von dem Genossen hören zu müssen. Und bei näherer Betrachtung: Wer spricht schon so, als wäre die eigene Stimme ein Geschenk an die Welt?
Die Debatte nimmt viele Formen an, einige passen in die Bibliothek, das Seminar, andere lassen sich nur in der Nähe des Bundestages und unter extremen Schichten der politischen Rhetorik erleben. Eine feministische Version davon ergibt sich aus der Analyse der Körper und Sprechweisen derjenigen, die sprechen . Ihre Worte sind, merken feministische und psychoanalytische Ansätze an, weich und verführerisch, ihrer Hyperverbalität ist schwer zu widerstehen. Die performative Theorieschule, die von J.L. Austin beeinflusst und von Jacques Derrida und Judith Butler weiterentwickelt wurde, greift die Unterscheidung selbst an und problematisiert die Art und Weise, in der Worte zu Handlungen werden. Seit es das Sprechen (mündlich eingesetzter semantisierter Zeichengebrauch) gibt, so Denker*innen wie die große Shoshana Felman, gibt es die Möglichkeit, mit Worten etwas zu tun. „Ich verspreche“ und „I do“ sind Äußerungen, die, gesellschaftlich gedacht, etwas tun, etwas schaffen: Das Versprechen, dass etwas getan wird, und der Beginn einer Ehe. Die Worte des ausdrucksbedürftigen Genossen können sich als leere Rhetorik erweisen, so dass jeder Satz nicht wirklich das bedeutet, was er sagt, eine Selbstverständlichkeit in der Politik. Das in einer Kirche ausgesprochene und unterzeichnete „I do“ schafft eine rechtsverbindliche Realität mit realen sozialen Folgen jenseits des gelangweilten Seufzens einer politischen Gruppe.
Eilige und kleinteilige Äußerungen stellen oft keine Handlung außerhalb der eigenen Mundbewegung dar. Wenn sie etwas tun, wird es schwieriger, weil eine Grenze überschritten wird, die die Tür zu anderen, komplizierteren Problemen öffnet, nämlich denen des Körpers und der Machtdynamik, die damit verbunden ist, etwas mit den eigenen Worten zu tun. In ihrer Analyse von Don Giovanni und Don Juan wagt Felman eine Erklärung für deren raffiniertes Verhalten. Beide sind Verführer, ihr Werkzeug ist die Sprache, sie reden, unterhalten sich, versprechen. Sie schaffen Realitäten. Sie versprechen den Frauen, dass sie heiraten werden, sie rechtfertigen sich und schaffen die ständige Illusion des Handelns. „Die Falle der Verführung besteht also darin, eine referenzielle Illusion durch eine Äußerung zu erzeugen, die von Natur aus selbstreferenziell ist„, sagt Felman, „die Illusion eines realen oder außersprachlichen Bindungsaktes, der durch eine Äußerung erzeugt wird, die sich auf sich selbst bezieht“ (S.17). Die Verführung erfolgt durch eine wesentliche Eigenschaft der Sprache. Aber nicht nur, denn wenn der Verführer sagt, was er sagt, steht eine andere Person vor ihm. Deshalb instrumentalisiert der verführerische Diskurs „auch gleichzeitig die Selbstreferenzialität des narzisstischen Begehrens des Gesprächspartners und seine Fähigkeit, eine reflexive, spiegelnde Illusion zu erzeugen: Der Verführer hält den Frauen einen narzisstischen Spiegel ihres eigenen Begehrens vor„. Das Sprechen wird dann im Dienste der Verführung instrumentalisiert, was in den Spielraum des Sprechers führt, der die andere Person mit Worten fast gefangen hält.
Der Verführer, oft in Gestalt eines Mannes, verwischt die Grenzen zwischen Theorie und Praxis, indem er sich selbst als privilegiertes Subjekt begreift, als Meister des Spiels, das sprachliche Manipulation ist. Worte sind jedoch nur eine Art und Weise, in der die Verführung in Erscheinung tritt, sie ist ein menschliches Element, weil sie einen Weg verfolgt, um etwas zu erreichen. Im Einsatz des Verführers sind die Worte zielgerichtet. Sexuelles Vergnügen, Geld, politische Vorteile sind der Gewinn. Diese höchst menschlichen Elemente verschwinden teilweise, wenn von der Verführung bei Tieren gesprochen wird, doch die grundlegendsten Triebe können nicht nur Licht auf die Motivationen beim Menschen werfen, sondern auch auf die Rolle von Bestimmung, Geschlecht und Performance. Worte können etwas bewirken, was passiert, wenn sie weggenommen werden, ist nicht so leicht zu beurteilen.
Luise Donschens erster Film „Casanovagen“ erkundet die Verführung, ihre Abwesenheit und ihr grundlegendes Verständnis jenseits der menschlichen Form. Die filmische Sprache ist also eine, die ihrem Gegenstand immanent ist und nicht von vornherein voraussetzt, was das Ergebnis ist. Genau das macht ihre filmischen Entscheidungen in ihrer Präzision fast wissenschaftlich. Indem sie die Verführung nicht nur als menschliches Phänomen begreift, werden die grundlegendsten Instinkte analysiert und dadurch Begriffe wie „soziale Konstruktion“ als sehr stark an den sprechenden oder beobachtenden Körper gebunden offenbart. Donschen nimmt von Anfang an einen forschenden Standpunkt ein, ihr Verständnis einer Totale ist eines, in dem sich die Figur, so eingerahmt wie in der ersten Szene des Films, sehen lässt und in das Alltagsleben eindringt.
Das erste, was ins Auge fällt, ist ein Hafen. Es sind sechs Boote da, von denen zwei nur teilweise sichtbar, aber so überzeugend ins Bild gesetzt sind, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein Körper taucht auf, er ist mit rosa und vogelähnlichen Motiven bekleidet, er steht vor der Kamera, andere Menschen kommen vorbei, gehen hindurch und bleiben manchmal stehen. Sie machen Fotos. Die analoge Qualität des Bildes wird deutlich, als ein Kind neben der Figur posiert. Das, was hier aufgeführt wird, ist nicht unbedingt als Gender-Untersuchung angekündigt, aber die seltsame Natur des Ereignisses, die statische Qualität der Bewegungen der Person und die Reaktion eines sichtbaren Publikums signalisieren, dass die Performance8Goffrnan, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Double Day Anchor Books. Garden City, NY. das Leben der Passanten auf ungewöhnliche Weise unterbrochen hat. Fragen nach der Bedeutung der Handlung sind natürlich, aber sie sind nur ein Teil der sorgfältigen Analyse von Informationen, die stattfindet. „Casanovagen“, der Titel des Films, erscheint kurz darauf.
Wenn die Schnittstrategien verstanden werden, kann der figurative Gedanke hinter dem Film gründlich erfasst werden. Techniken der Lesbarkeit müssen durch das Unlesbare, durch das scheinbar Ungewöhnliche erfasst werden. Das sind die Lücken, die den Film vervollständigen. „Casanovagen“ begreift seinen Schnitt als desorientierend hilfreich: Ein Computer erscheint mit einigen überwachten Vögeln, die von einem Menschen angeschaut werden. Das Bild gibt sich den Geräuschen der Vögel hin und es folgt eine Beschreibung, gesprochen von einer schräg nach links blickenden männlichen Figur: „Wenn das Weibchen bereits dabei ist, hält sie sich entweder ruhig oder sie kann ihn aktiv durch Schwanzvibrieren zum Kopulieren auffordern.“ Dann folgt das analoge Bild dieses Vorgangs, das mit dem zuvor gesehenen Computerbild der Vögel interagiert.
Der Impuls zur Anthropomorphisierung ist stark, die Wahl besteht darin, den Prozess der Vögel als etwas ihnen Eigenes zu verstehen oder als etwas, das eine universelle Form ausdrückt, die sich auch für die Analyse des Menschen gut verwenden lässt. Allerdings nimmt der nächste Schnitt, wie der größte Teil des Films, den Gedanken fast magisch vorweg. Ein Vogel springt, Musik setzt ein. Der radikale Wechsel des Schauplatzes wird durch Zitronen auf einem überdimensionalen Glas signalisiert. Die Menschen, die die Bar bevölkern, schauen und bewegen sich, gleichen ihr Verhalten unter dem sanften Klang der Musik an. Ihr Geschlecht bleibt undefiniert.
Der offensichtlichen Gleichsetzung muss widerstanden werden, denn ihre Problematisierung wird durch die Schichtung des Films, seine Fähigkeit, Kontextwechsel zu erzeugen, aktiv herbeigeführt. Vögel sind keine Menschen, Menschen sind keine Vögel. Wenn Anforderungen zwischen Menschen gestellt werden, dann sind sie subtil, Teil der Choreographie der Paarung. Was sich in der Bar abspielt, ist der Eintritt ins Soziale als eigenständige Ebene. Die menschliche Sprache ist kein Gezwitscher. Langsame Bewegungen, Beobachtungen und das vorsichtige Aushandeln von Proxemik können genauso komplex sein, nicht besser oder schlechter, als das, was Vögel tun.
Die eine Person mit blondem Haar, die vorher gesehen wurde, schaut auch zu, sie tanzt, sie raucht. Keine Worte, das Ganze basiert auf einer Stimmung, dem Leuchten einer scheinbaren Nacht. Wie aus dem Nichts kommt ein Mann, der ihr links weniger Platz lässt. Sie geht weg, die Kamera geht mit einer anderen Person weg, einer männlichen Figur, deren zwei Bewegungen darin bestehen, ins Bild zu gehen und sich zu küssen. Zuweilen ist es für die Menschen einfach, das zu tun, was sie sich in Bars vorgenommen haben. Eine andere Figur setzt ihren Tanz fort, während die blondhaarige Figur zu rauchen beginnt.
Die Hände übernehmen eine kleine Rolle. Die eine gibt Feuer, die andere nimmt die Musik weg. Die Figuren sind in ihrer eigenen Welt, nur durch ihre Verkettung miteinander verbunden. Die Person zieht ihre Jacke aus, die Zigarette fällt herunter, sie schaut zur Seite, aber die nächste Einstellung zeigt nicht, was sie sieht, sondern ihre Füße, die die Zigarette weglegen. Die Hierarchie ist flach, die Prioritäten sind gesetzt: eine Zigarette auf dem Boden ist nicht weniger wichtig als die menschliche Figur, die vielleicht auftaucht oder auch nicht. Die Zigarette wird liegen gelassen, jemand tritt darauf. „Vicky“, die Figur aus dem Off, erscheint in Form von Händen und einem Buch, und dann ihre Stimme, die geduldig daraus vorliest. Es folgt eine Einstellung der Person, die wir gerade gesehen haben, ihre Augen schauen in die Ferne. Was gesagt wird, wird nicht im Gespräch ausgesprochen, sondern ist wie eine Welle zu spüren, die auf die Körper zukommt. Und was gesagt wird, ist:
„Nach Untersuchung aller dieser Misslichkeiten, denen wir Männern nicht unterworfen sind, frage ich, ob man annehmen muß, daß die ›semper sibi consona‹ “„stets sich selbst getreue“ und in ihren Reaktionen und Ausgleichen stets gerechte Natur dem weiblichen Geschlecht an Lustgefühl zum Teil werden ließt, dass es für die von ihm untrennbaren Verdrießlichkeiten entschädigt. Jedenfalls kann ich versichern, dass die Lust, die ich empfand, wenn mich eine geliebte Frau glücklich machte, sicherlich groß war, dass ich aber gewiss verzichtet hätte, wenn ich mich dieser Lust wegen der Gefahr hätte aussetzen müssen, schwanger zu werden. Die Frau nimmt das selbst dann auf sich, wenn sie diese Erfahrung schon mehrmals gemacht hat; sie findet also, daß die Lust den Einsatz wert ist. Nach allen diesen Überlegungen frage ich mich, ob ich als Frau wiedergeboren werden wollte, und trotz der Neugier sage ich: nein. Ich habe als Mann genügend andere Freuden, die mir als Frau nicht zugänglich wären und mich mein Geschlecht dem anderen vorziehen lassen.“
Die Person hört auf zu lesen und schaut zu ihrem Gegenüber, sie schaut nicht zurück, sondern nach oben in einen Spiegel, in dem viele Menschen zu sehen sind. Die Worte gehen unter den Boden, sie wirken unterirdisch. Was gesagt wird, entspricht nicht dem, was gezeigt wird, daraus ergibt sich die Wechselbeziehung. Die Welle plätschert in den Körper, aber sie „besiegt“ ihn nicht, sie bewirkt eine Wirkung, umspült ihn und tritt dann wieder in den Hintergrund, um auf die nächste Schallwelle zu warten. Der Klang wirkt also im Schatten. Die Beschränkung des Körpers auf eine Stimme, die technische Abgrenzung und Isolierung der Schallwellen der Sprache, schaffen die perfekte Bildebene für ihre Wirkung. Schall kann gebrochen, übertragen, absorbiert oder reflektiert werden, wenn er auf eine Grenze stößt.
Das Kino präsentiert die akustische Situation nicht als Gleichung, sondern als gelebte Realität, der Donschen große Aufmerksamkeit schenkt. Die Schallwelle erzeugt keine Resonanz im Bild, die Figur bleibt im Hörmodus, aber der Klang und der Inhalt der Rede, in diesem Fall die Worte von Giacomo Casanova, sind nicht nur dazu da, einfach absorbiert zu werden, sondern die filmische Kulisse liefert den Boden für die anderen Effekte. Casanovas Worte bleiben gebrochen in der Luft des Films, seine Stimmungen und Wünsche treffen auf Bilder und assoziieren sie mit seinen Überlegungen, wie das Zwitschern der Vögel als assoziative Knoten für die kommenden Bilder. Der Ton ist eine Welle, die uns alle erdrückt.
In der Reflexion mit anderen Konfigurationen erzeugt Casanovas Rede mehr Assoziationen, nicht nur in der Verkettung der Bilder, sondern auch im Kopf des Zuschauers. Die blonde Figur wird hier als filmische Rezipientin verstanden, aber nicht als privilegierte Verarbeiterin der Botschaft, in die auch wir eingeweiht sind. Casanovas Worte sind nicht dazu da, um die Wahrnehmung anzuregen, sondern um an der Figur abzuprallen. In der erwähnten Rezeptions- und Übertragungsweise stößt Donschens ausgeprägtes filmisches Vokabular auf ein besonderes Problem, das es nicht löst, sondern dem Zuschauer auferlegt. Sind diese Worte nur für bare Münze zu nehmen, sind sie da, unabhängig von dem, was man sieht? Der ontologische Status des Wortes taucht in Casanovagen immer wieder auf, gerade weil er sich einer einfachen Übertragung verweigert. Bilder und Töne sind nicht dazu da, um eine einfache Harmonie der Disharmonie zu schaffen, um zueinander zu „passen“, sondern um produktive Widersprüche und Probleme zu erzeugen, die zum Betrachter zurückkehren. Die isolierte Stimme verlangt, gehört zu werden, vielleicht nicht von der Figur, aber sicherlich vom Betrachter. Die Wellen seiner Rede sind Leckerbissen an Informationen, die durch die weiblich klingende Stimme, die den selbstgefälligen Macho-Ton durch eine zitierende Kadenz ersetzt, verändert werden. Sie hackt seine Rede, ironisiert sie und führt sie doch zu einer egalitäreren Sprechweise zurück.
Und auch hier kommt Casanova ins Spiel, diesmal in Form eines Schauspielers, der die Rolle verkörpert. Die Aura des Zitats wird durch die Darbietung unterstrichen. John Malkovich verkörpert ihn, doch er fühlt sich nicht wie Casanova. Das liegt an seinem Charakter, den man nicht ändern kann, wohl aber sein Temperament, wie der Schauspieler einer Person gegenüber erklärt. „Ich war der Tanzbär und Bären tanzen.“ Donschen wechselt zwischen den verschiedenen Szenarien hin und her, und beim nächsten Schnitt werden wir wieder in die Welt der Vögel und der Evolutionsbiologie zurückversetzt. Dies bietet Gelegenheit für ein Gespräch über den Determinismus bei Vögeln, bei dem die Vorliebe für das Fremdgehen bei den Männchen durch ihre schiere Männlichkeit und bei den Weibchen durch das „Casanovagen“ der Männchen erklärt wird. In beiden Fällen bleibt das Männchen handlungsfähiger, während die Evolutionsbiologie nicht verstehen kann, warum die Weibchen betrügen sollten, wenn es keine offensichtlichen Vorteile gibt.
Zurückgedrängt auf Geburt und Determinismus, werden spielende Kinder im Park beobachtet. Sie spielen, sie nehmen Sachen und gehen, sie berühren sich. Der Prozess der Erkundung und Beziehung begreift die Bilder als potenziell, aber nicht notwendigerweise aufeinander bezogen. Die Stränge können unabhängig voneinander bleiben. Die Eier in der folgenden Aufnahme haben vielleicht nichts mit den Kindern zu tun, und doch ist ihre Paarung nie zufällig, sondern es handelt sich um die Präsentation eines Gegenstandes, seine mögliche Erklärung und eine Familienähnlichkeit in Bildern.
Fünf Szenarien sind nun entstanden, und bald werden es mehr sein, aber das Wichtigste ist, jedes einzelne Szenario zu hinterfragen, an das die Figuren gebunden bleiben. Sie bewegen sich nicht von einem zum nächsten, die Kontinuität wird in diesem Sinne unterbrochen, um eine stärkere sinnlich-thematische Bindung zu schaffen. Wenn die Figuren also Fragen der Performativität, der Kopulation und der Fähigkeit, Dinge in anderen Spezies, aber nicht in unserer eigenen, zu erklären, aufgeworfen haben, ist es normal, dass wir in den materiellen Bereich zurückgeworfen werden, denn diese beschreibbaren Dinge sind keine bloße Theorie.
In der Bar entspinnt sich ein Gespräch über Geschlechtsoperationen. Ohne die Gebärmutter gibt es im Fall der Sprecherin kein Begehren. Die Beziehung zwischen Geschlecht, Biologie und Performance führt den Diskurs des Films auf ein schwieriges Terrain, das nicht einfach aufgelöst, sondern in Form mehrerer Fragen an den Zuschauer gestellt wird. Wie im Fall der Bilder einer Sexarbeiterin, die sich der Demütigung des Kunden hingibt, oder der Hingabe, die die Kirchenarbeiterinnen empfinden. Die Ökonomie dieser Szenarien, in denen Füße, Geld, Blumen und Gesten inszeniert werden, verlangt die Aufmerksamkeit auf ihre entpersönlichenden Mechanismen. Was wirklich wichtig ist, liegt in diesen Gesten und Bildern, nicht in der inneren Psychologie der Figuren. John Malkovich, der John Malkovich spielt, wie er gesehen werden will, nicht wie er vielleicht „ist“, wird zu einer offenen Frage. Verführung kann durch Worte geschehen, kann auch mit ihnen etwas bewirken, aber das Begehren ist nicht nur das Reich des Verführers, denn biologische und emotionale Notwendigkeiten haben nicht nur rein mit dem sexuellen Akt zu tun. „Meine Seele verzerrt sich in Sehnsucht…“ ist kein Satz von Casanova, sondern aus dem Inneren der Kirche.
Führt man das filmische Spiel der Ähnlichkeit zu seiner letzten Konsequenz, so kommt es zu einer Konfrontation mit den Problemen, die entstehen, wenn die durch den Schnitt eröffneten Spiele der Referenzialität unweigerlich auf den Macher treffen, der die Kontrolle zu haben scheint. Als das Interview mit John Malkovich zu Ende ist, sehen wir das Kamerateam im Spiegel, und uns wird signalisiert: Das ist der Film und die Person, die die Frage stellt, ist wahrscheinlich die Regisseurin. Die physische Figur Casanovas hat ihr in die Augen geschaut, ganz nah und persönlich, und von nun an ist sie in der Geschichte impliziert, so wie sie es immer war. In diesem letzten Abschnitt kommt es zu einer ganzen Reihe von Umwälzungen. Nicht nur in diesem einen Szenario wird die Regisseurin enthüllt, sondern auch im Vogel-Szenario, wo ein Ortswechsel notwendig ist. Jetzt ist die Regisseurin zu sehen, der Evolutionsbiologe ist bei ihr, der Ort ist die Kunsthalle Hamburg. Hier schauen sie, hier sitzen sie zusammen und umarmen sich zu den süßen Klängen eines geflüsterten „Meine Sträuße“. Eine leere Badewanne erscheint. Und die Szene wechselt zur Domina, die nun dominiert wird. Nicht durch gewaltsame und schwer zu sehende Bewegungen, sondern durch das Wort und die minimale Berührung. Wie Clement Knox in seiner Geschichte der Verführung darlegt, gibt es eine dynamische Spannung zwischen Vernunft und Leidenschaft, die sich in der Verwendung der Hypnose als Metapher für die Verführung entfaltet. Die Bilder, die Donschen findet, um dies zu zeigen, sind erfrischend unmetaphorisch. Hier wird die Verführung durch Worte explizit gemacht, das Biologische in seiner Einfachheit.
Die Erfahrung scheint mit dem Orgasmus zu Ende zu sein, was jedoch nicht bedeutet, dass Donschen aufhört zu zeigen. Während der Boden gereinigt wird, kehrt das Publikum ein letztes Mal in die Bar zurück. Während die Leute sich umschauen, spielt sich um eine Discokugel herum ein ziemlich genaues Mitternachtsszenario ab. Ein Kate Bush-Song beginnt und eine Person fängt an, einen unstrukturierten, aber kontrollierten Tanz zu vollziehen. Der Körper, er spricht, er sagt viel und auch nichts. Mit einem Knall endet der Film, die Fragen, die sich stellen, weichen der Selbstbefragung. Worte zu benutzen, den Körper zu benutzen, bedeutet, die Komplexität dieser Themen zu verstehen, die biologischen Schichten, die Verführung, die Entschlossenheit, die Worte, die sich in Körper verwandeln, das Flüstern in der Nacht. Und sich nicht von all den Problemen, die sie aufwerfen, überwältigen zu lassen. Sondern zu verstehen und dennoch in der Lage zu sein, innerhalb der Komplexität einer begrenzten Freiheit zu tanzen, wie man will.
Körper in Ganze Tage Zusammen
Neurodivergente Themen werden oft mit dem Feingefühl eines Infomercials behandelt, das nach Ansicht der Macher das effizienteste System zur Informationsvermittlung ist. In diesen Spots spricht ein Moderator über die Vorzüge von Produkt oder Dienstleistung X. Die Ästhetik ist in Bezug auf Farben und Präsentation eher minimal und die Ansprache tendiert zum persönlichen „Du“, was eine Möglichkeit ist, die unvermeidliche Distanz zu überbrücken, die durch technische Vermittlung entsteht. Die direkte Adressierung geht davon aus, dass das Publikum sich beim Betrachten von etwas oft bereitwillig auf eine Rezeptionsweise einlässt, die durch eine implizite Akzeptanz einer anderen Ebene der „Realität“ gekennzeichnet ist (das, was in der Psychoanalyse oft als „Fantasie“ bezeichnet wird, was oft zu fragwürdigen Schlussfolgerungen führt), und dass diese Ebene durchbrochen, gestört werden muss. “Jetzt ist dieses Ich, das mit dir spricht, real und wir sollten über dieses Ding sprechen, das verkauft wird. Das brauchst du unbedingt.“
Neurodiverse Reportagen und Filme sind von dieser Art des Sprechens geplagt. Die direkte Ansprache ist dazu gedacht, darüber zu sprechen, dass dieser Zustand real ist. Das passiert wirklich, viele Menschen um dich herum könnten Autist*innen sein. Und ja, sie sind vielleicht komisch, aber sie haben auch Gefühle. Es ist verlockend, eine Unterscheidung zu treffen und klarzustellen, dass hier nichts verkauft wird, sondern es nur um Informationen über Autist*innen geht, aber dem sollte man entschieden widerstehen. So wie der Infomercial nicht nur informiert, bringt der Film über Neurodivergent*innen nicht nur Themen ans Licht, die sonst zu wenig Beachtung finden. Sie verkaufen ein bestimmtes Bild des Denkens, nicht nur ein Stereotyp, sondern eine Reihe von Bildern, die miteinander interagieren und Verbindungen und Schlussfolgerungen schaffen, die ein lebendiges Bild darstellen. Es entstehen Zusammenhänge. Stereotypen werden angereichert. Und spektakuläre Bilder bleiben nicht einfach stehen, sondern wandeln sich, tarnen sich, verstehen, dass mit der Zeit neue, körnigere und spezifischere Bilder geschaffen werden sollten, die sich mit anderen verbinden und Zusammenhänge bilden.
Neurotypische Denkweisen arbeiten mit dieser Methode besonders effektiv, weil sie nomadische Bilder in streng kontrollierte Verkettungen einsperren. Es mag den Anschein haben, dass die Form variiert, aber was sich ändert, sind die Formate, oft die Kameras, und die Struktur des Gefühls einer bestimmten Zeit. Aber die „Form“ interagiert mit der Materie, wenn beide Dinge miteinander verflochten sind, und die „Neuheit“ entsteht durch unterschiedliche Ansätze zu beiden Aspekten. Industrielle autistische Bilder tun ihr Bestes, um diese zu trennen. Das Verständnis der filmischen Grammatik wird ätzend an eine bestimmte Syntax gebunden. Repräsentationen der Behindertenkultur werden oft so verpackt, als gäbe es die Figur nicht, sondern nur einen Typus, ein Merkmal, das die Erzählung übernimmt. Die Ästhetik der Behinderung kämpft gegen das, was Julia Miele Rodas eine Anhänglichkeit an die Entkopplung von Figur und Handlung nennt9 Rodas, J. M. (2018). Autistic disturbances: Theorizing autism poetics from the DSM to Robinson Crusoe. University of Michigan Press.. Informative Filme, die sich mit Behinderung befassen, entmenschlichen, indem sie sich mit Informationen befassen. Der Umgang mit dem Fleisch und den Knochen der behinderten Menschen wird beiseite gelassen, und der Umgang mit Situationen, oft schwierigen, in denen der behinderte Mensch benachteiligt wird, ist die Norm.
Ganze Tage Zusammen funktioniert anders. Denn es knüpft seine erzählerischen Pointen an ein Körperkonzept, das weder vorgezeichnet noch autoritativ behauptet ist. Seine Figuren sind produktiv ausgeschnitten und begeben sich in Situationen, sind gerahmt, so dass das primäre Anliegen, die Beschäftigung mit ihrem Körper, nicht irgendeinem Körper, filmisch thematisiert wird. In der trügerischen Einfachheit seiner Kompositionen sind die Figuren oft sehend, in kleinen Interaktionen mit sich und anderen. Die Körper schwingen zu den Klängen unserer eigenen Biologie und unseres unmittelbaren sozialen Umfelds. In diesem Sinne sind wir alle verschieden, und doch schwingen wir alle, nur sind diese Schwingungen nicht richtig eingefangen worden und haben keinen angemessenen Raum erhalten. Den Körper in ein starres Schema zu pressen, bedeutet in gewisser Weise, ihn zu entstellen. Der epilepsiekranke Körper verändert die Interaktionen der Epilepsiekranken mit ihrer Umwelt, eine andere Schwingung kann unerwartet auftreten, mit schwierigen sozialen Folgen. Doch wenn man sich auf all diese negativen Aspekte konzentriert, vergisst das spektakuläre Bild der Behinderung hinderlich die Würde dieser Körper und die darin enthaltene Schönheit.
Das Verfolgen von Körpern erzählt Geschichten auf eine besondere Art und Weise. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Augen, die Hände, die Füße, die Ökonomie der Gesten, die auf einen Mangel an erzählerischer Überdeterminierung abzielen. Die Schulkinder, von denen eines erst kürzlich durch eine Epilepsiebehandlung „geheilt“ wurde, genießen ihre Zeit, gehen spazieren, sehen Unfälle, erleben andere Wesen, ihre Blicke leuchten so hell wie das natürliche Licht, das sich zwischen den Bäumen und dem Gras entfaltet. Die liebevolle Geste ist universell, die Elemente des Bildes sind gleichberechtigt, ohne vorzugeben, dass dieser Baum hier besser ist als der Körper des epilepsiekranken Kindes, ihre Stimmen haben keinen Vorrang, ihre Berührungen eines Kaninchens genießen keinen Vorrang vor ihm. Das Geräusch eines Autos, das in etwas Winziges kracht, kann eine große Wirkung haben, selbst wenn das Auto nirgends zu sehen ist. Die filmische Gleichmacherei suggeriert die Freiheit der Figur, die sich in nonverbaler Taktilität mit anderen unterhält. Im Gegensatz zu Casanovagen fehlt hier die Überzeichnung, an ihre Stelle tritt eine assoziative Lockerheit. Die Figuren sind dem Licht ausgesetzt und warten darauf, gesehen zu werden. Ihre Worte bleiben flüchtig, meist losgelöst von sich selbst.
Der Sieg des 4:3 Seitenverhältnisses ist nicht unbedeutend, er fegt mit dem Rest, dem Unwesentlichen in jedem gewählten Bild hinweg. Die Komposition steht dann im Mittelpunkt, sie begreift wahnhaft und doch beherrschend die Seiten der Körper, die zu sehen sind. Ganze Tage Zusammen beginnt damit, dass ein Vorhang geschlossen wird, das Licht herausgenommen wird, um es aufzunehmen und entsprechend zu formen. Dann flackert der Bildschirm, ein Computersound ist zu hören. „Augen wieder auf und zu„, ein ähnliches Bild wie bei Casanovagen taucht auf, eine Person schaut in den Computer, überwacht etwas. Doch die Erklärung des Bildes wird nicht verbalisiert, sondern gezeigt. Eine Figur wird vorgestellt, indem Sensoren von ihrem Kopf genommen werden, und ein intelligenter Schnitt führt uns zu einer scheinbar gewöhnlichen Aufgabe, dem Zähneputzen.
Die Einfachheit dieser Organisation zeichnet eine figurative Strategie nach, bei der die nächste Einstellung dem Film keinen expliziten Wert verleiht, sondern immer etwas mehr hinzufügt, etwas mehr erfindet. Da Dialoge bis zum Ende des Films vermieden werden, wird stattdessen Bewegung gesehen, Hände, die Dinge abnehmen, Dinge greifen, Körper, die durch den Boden gefegt werden. Ein ruhiger Blick, eine Gestalt, die stur geht. Jemand blickt zu Boden und das Bild des Blicks kehrt wieder. Hier, in diesem Moment, sind die Menschen anwesend, ihre Körper sind griffbereit, leben und atmen vor uns, neben uns. Ihre Aktivitäten sind aufgrund ihrer Individualität wichtig, zusammen bilden diese Aufnahmen mehr als die Summe ihrer Teile. Angst, Hoffnung, Entstabilisierung. „Reaction shots“ sind oft die nächste Einstellung, die die vorhergehenden richtig rekonfiguriert und der Komposition so etwas wie ein interaktives Element hinzufügt: Die Figuren tun etwas, berühren etwas, verstehen etwas und lassen sich durch diesen Akt selbst verstehen. Wenn Bielefeld nicht existiert, wie man sagt, dann existieren die Figuren, die diese Filme bevölkern, dreifach. Ihr Lachen, während sie etwas beobachten, ist lebendig und körperlich, und sie gestikulieren, beleben eine Realität, indem sie in dieser kompakten, klug gewählten Komposition existieren.
Einfachheit ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für jeden Film, dem es um eine Erneuerung der filmischen Grammatik geht, dessen Sequenzen anders ticken, weil das Gezeigte, Gesagte, Bezeichnete, Veränderte, Thematisierte, Gehörte und Abgebildete in die Mittel des Kinos eindringt und diese, wenn auch nur minimal, modifiziert, wenn es erlaubt ist. Dann entstehen andere Konfigurationen, an die man vorher nicht gedacht hat. Ein Unfall ereignet sich, er wird durch den Schnitt nur minimal angedeutet und nicht grafisch durch das Bild der Figur dargestellt, der der Unfall physisch widerfahren ist, sondern nur durch eine Reaktion, einen gezeigten Körper. Hier wird der Unfall durch seine Folgen gezeigt, es gibt eine Figur, der der Unfall auch passiert ist. Sie ist auf dem Bild zu sehen. Das direkte Opfer bleibt aber im Off, denn auch dieser Raum ist kuratiert.
Die alten Filmemacher*innen hatten dafür einen Namen: Respekt. Das Off ist ein dialektischer Raum, der mit dem On interagiert und ihm Informationen, Töne, Bilder und Farben hinzufügt. Die Dignität dieses Raums ist ein Zeichen des Engagements für die Reflexion des Kinos. Es gibt ein Außerhalb des Films, es anzuerkennen bedeutet, mit ihm zu spielen, ohne dass Gedankenlosigkeit einsetzt. Und dennoch: Nicht alles kann neu definiert werden, Filmemacher*innen sitzen auf den Schultern von Giganten. Eine einmalige Einstellung muss nicht neu gedreht werden, deshalb schauen die Figuren aus dem Bild heraus, ihre Blicke fordern den Zuschauer auf, ihnen zu folgen. Was dann kommt, ist eine Erfindung des Films, wie sie zustande kommt, und beruht auf der Geschichte des Kinos, ohne dass man über akademische Querverweise reden muss.
“IN EINEM ANDEREN SCHREIBEN” (Les Guérillères, Monique Wittig) wird jeder Satz in dem Film präsentiert. Die Körper, so gesehen, brauchen keine wortreiche Erklärung davon, was in der Erzählung vorgeht, da sie in anderen Umständen invasiv vorbestimmt werden. Es ist genug zu sehen, wie sie ins Licht kommen und da bleiben, ein Blickrichtungswechsel kann zu Tränen führen.
Zeugenschaft in Elle
In den ersten Sekunden von „Elle“, dem letzten Film, den Luise Donschen bisher gedreht hat, ist die japanische Schrift zu sehen, dann die phonetische Übersetzung und dann das Französische. Die Interkulturalität der verschiedenen Sprachen wird jedoch durch die phonetische Umschrift des Japanischen gestört. Denn etwas, das man sehen, aber nicht lesen kann, führt zu Verwirrung, die Lautschrift ist dazu da, das Problem zu lösen, indem sie Dinge durch Zeichen hörbar macht. Auf die mündliche Kultur wird also paradoxerweise hingewiesen, bevor es überhaupt etwas anderes als den Titel gegeben hat. Diese Kultur versteht die stille, gleichmacherische Kraft der Sprache als ein phonetisches Ereignis, das nicht eindeutig reproduzierbar ist.
Geschichten und Erzählungen sind in dieser Art des Denkens, die mit vielen nicht-hegemonialen Bevölkerungen verbunden ist, leichter auf personalisierte Weise zu verbreiten. Änderungen erschweren es oft, zu einer ursprünglichen Version zu gelangen, verleihen den Äußerungen aber einen eigenen Ton und eine eigene Persönlichkeit. So entstehen an verschiedenen Orten der Welt unterschiedliche Versionen von Geschichten, die nicht reproduzierbar sind. Daraus entsteht Hybridität, und dank der unendlichen Möglichkeiten der Globalisierung wird der Austausch dieser Versionen ermöglicht. Dennoch bleibt die mündliche Kultur ein geeigneter Ort, um bestimmte Dinge mitzuteilen, auch wenn sie nicht vollständig verstanden werden.
Die Struktur von „Elle“ weist auf eine mögliche Form von Luise Donschens Arbeit hin, die sich nicht zu erschöpfen scheint, sondern sich eher erweitert. Die bisher verwendete kleinteilige Rahmung des Körpers wird produktiv kombiniert mit Schatten, Verweisen auf Figuren, die nur als solche erscheinen, vielleicht kommt später noch etwas hinzu. Die Fragmentierung weist den Weg für kleine Erklärungen und Dialoge, in denen die Figuren nur teilweise verstanden werden. Ihre Worte müssen unabhängig voneinander verstanden werden, nur in Bezug auf das, was da ist, nicht auf das, was diese Worte im größeren Kontext eines Dialogs bedeuten könnten.
Die Wortfolge begleitet das Bild, das sich nun auf Zustandsveränderungen konzentriert: Zwei Menschen unterhalten sich, Gras ist zu sehen. Dann erscheint plötzlich das Licht in derselben Einstellung, die Figuren werden deutlicher wahrgenommen, verstanden und doch verborgen. Die Sprachen, in denen sie sprechen, sind Französisch, Englisch, Japanisch und Deutsch. Es ist Learning by Doing. Bald entpuppen sich die Gestalten als Kind und Vater. Ihre Körper, Figuren der Präsenz, sind nachgekommen und werden daher zu den zuvor gesehenen Schatten hinzugefügt. Eine Besonderheit: die Entkopplung von Körpern, Identitäten und Subjekten.
Sie sind gehende, sprechende Körper, die die Welt sehen und erleben, als wäre sie neu, denn der Film arbeitet mit der Notwendigkeit der Schöpfung, dem liebevollen Gefühl, den Boden unter den Füßen zu entdecken. Geräusche bevölkern die Welt, in jeder Sekunde wird etwas geschaffen, das vielleicht schon vorher da war, aber nicht auf diese Weise.
Dem*der Betrachter*in werden auch Anweisungen zum Sehen gegeben, nicht nur durch den Titel, sondern auch durch die Namen der Figuren. So ist ein Gärtner zu erkennen, aber nicht nur dadurch, sondern auch dadurch, dass die Figur arbeitet und strohbedeckte Pflanzen trägt. Der Gärtner hört einen Körper in der Nähe, es ist das Kind, dargestellt durch Geräusche. Ihre Interaktion ist unsichtbar und doch materiell, sie müssen sich nicht direkt unterhalten, um einen Moment zu haben, um einander zu beeinflussen und voneinander beeinflusst zu werden.
Die Ereignisse erscheinen wie eine zufällige Aneinanderreihung, aber sie verraten mehr über die Art und Weise, wie die Menschen mit der Welt umgehen. Interaktion ist keine Erfahrung, die sich auf den Klang von Worten beschränkt, auf die reagiert wird. Eine sitzende Person erscheint im Bild, es ist die Frau auf der Bank, und der Vater sitzt neben ihr. Während er sich Postkarten ansieht, sind die Augen der anderen Person geschlossen. Er schreibt eine Postkarte auf Englisch und wird nur dadurch unterbrochen, dass der Kopf der Person auf seine Schulter gelegt wird, in die Komposition eintritt und sie verändert.
Ihre Füße sind zu sehen. Sie hebt ein Buch vom Boden auf und spricht Japanisch. Die andere Person tut dies nicht. Es gibt keine Missverständnisse. Die Person will sprechen und erzählt von Elle, ihrem Hund, im Rhythmus eines leisen Tons. Ihre Worte gehen über den Rahmen hinaus, sie tritt nicht in einen Dialog mit dem Vater, sondern führt einen Monolog. Ihr Blick, der auf einen bestimmten Punkt außerhalb des Bildes gerichtet ist, verändert sich minimal und kommt der Traurigkeit immer näher.
Die drei Minuten des Monologs enden mit dem Bild eines Baumes, bevor sie geht. Aber als sie auf Englisch „thank you for your time“ sagt und weggeht, ist der Körper des Vaters nicht mehr zu sehen, es scheint, als sei er schon vor einer Weile gegangen. Das Publikum bleibt zurück, während sie spricht, als Zeugen ihrer Nostalgie, aber auch als ungewollte Objekte der Ansprache. Die filmische Realität wird also für die direkte Ansprache geöffnet, mit dem Vorbehalt, dass diese nur formal signalisiert wird und nicht als Teil der Geschichte gezeigt, nicht gesagt wird. Als die Frau ihren Monolog beendet, wendet sie sich nach rechts, blickt auf einen Baum, der Zeuge von allem war.
Das Kind beobachtet auch den Gärtner, der auf seine Weise Magie in die Arbeit einbringt, ohne direkt zu interagieren. Die beiden Figuren, der Erwachsene und das Kind, treffen sich im Spiegel, die Reise zum Garten ist zu Ende. Als sie mit ihren Fahrrädern von links nach rechts abbiegen, springt das Kind auf und blickt in Richtung Kamera, es ist eine Supertotale. Die Blumen sind zu sehen, ein Lied ist zu hören. Der Ton trifft mehrmals auf die Bilder und lässt die Umgebungsgeräusche sprechen. Des Films Triumph ist die ausstrahlende Liebenswürdigkeit, die sich in jedem der hier besprochenen Filme finden lässt. Bedingungslos und bereit, sich die Welt anzuschauen und eine eigene zu konstruieren, als wäre es das erste Mal.
Danke an Luise Donschen für die Links zu den Filmen.
Notes
- 1„Like a Virgin“ (1984)
- 2“Zurück zu Freud!” oder Dervin, D. (1997). Where Freud was, there Lacan shall be: Lacan and the fate of transference. American Imago, 54(4), 347-375.
- 3McGowan, T. (2016). Capitalism and desire: The psychic cost of free markets. Columbia University Press.
- 4Hansen, M. B. (2015). Feed-forward: On the future of twenty-first-century media. University of Chicago Press. p.4.
- 5Shambu, G. (2020). The new cinephilia. caboose.
- 6Arndt, A., Kruck, G., & Zovko, J. (Eds.). (2014). Gebrochene Schönheit: Hegels Ästhetik-Kontexte und Rezeptionen (Vol. 4). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- 7„Holiness“ von Robert MacSwain in Goetz, S., & Taliaferro, C. (Eds.). (2022). The encyclopedia of philosophy of religion. Wiley Blackwell.
- 8Goffrnan, E. (1959). The presentation of self in everyday life. Double Day Anchor Books. Garden City, NY.
- 9Rodas, J. M. (2018). Autistic disturbances: Theorizing autism poetics from the DSM to Robinson Crusoe. University of Michigan Press.