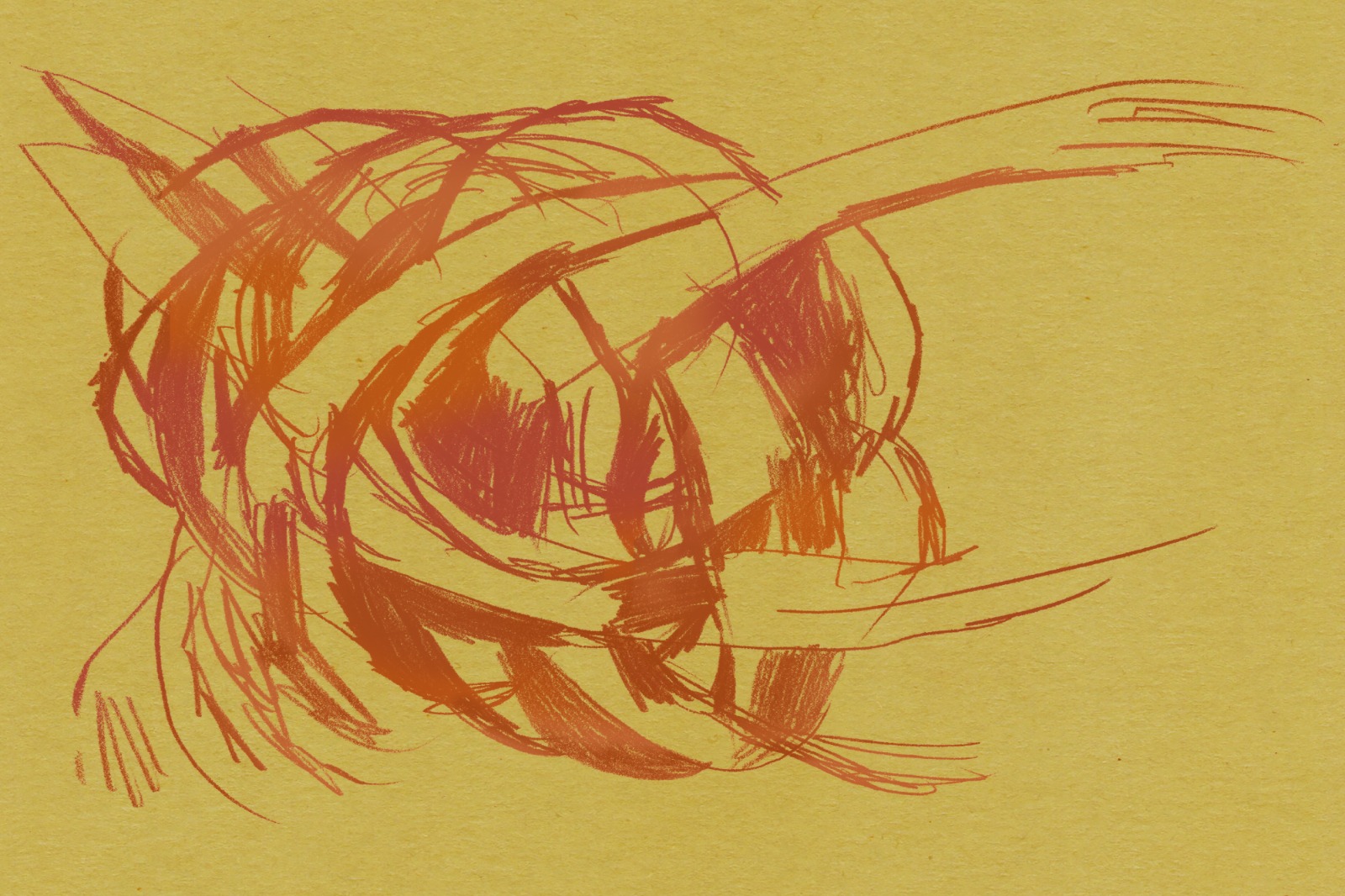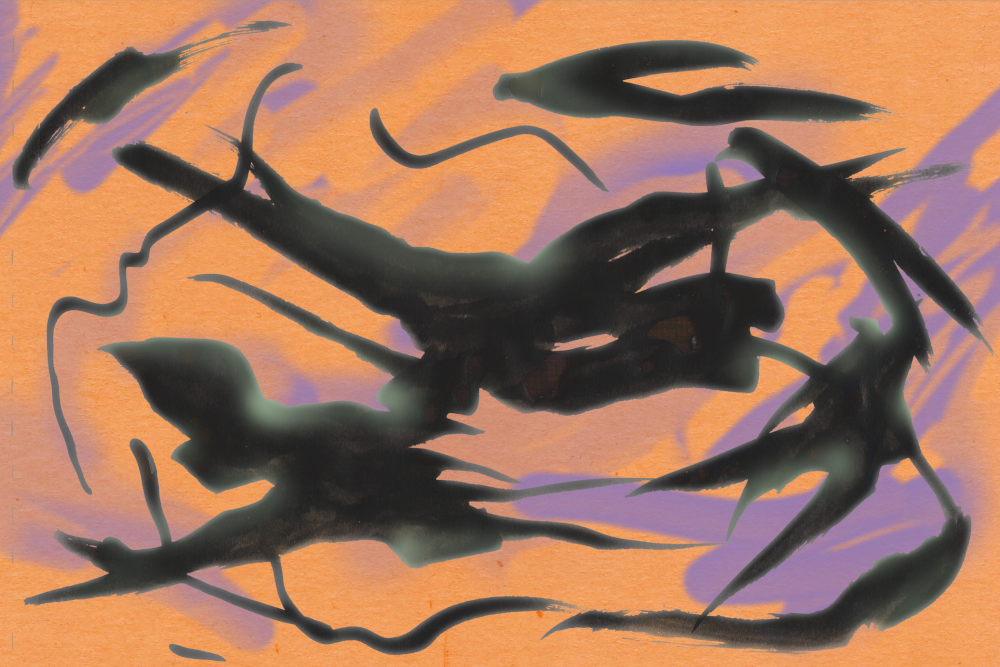Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag
Die liberale Vorstellung der Kommunikation, bei der Menschen miteinander sprechen, in der sich jedes schwierige Verfahren des Alltags bloß mit dem Schlüssel der korrekten Formulierung in Luft auflöst, verbreitet gefährlicherweise die verworrene Idee, dass alles ausgesprochen werden muss, da sich im Laufe des Kommunikationsprozesses irgendetwas offenbaren wird, das in seiner expliziten Formulierung zum Verständnis führt. In der Forschung scheinen sich diese Probleme beispielsweise in der Medientheorie von der linguistischen Forschung und der neurologischen Untersuchung der Diskussions- und Interaktionskultur weg und hin zur Untersuchung des virtuellen Kommunikationsverfahrens zu bewegen. Diese Entwicklung folgt freilich dem Gewinnmotiv, da die Aufmerksamkeit, der Hype, auf das gerichtet wird, was fremd und unerklärlich erscheint. Das Vertraute und Alltägliche scheint schlichtweg uninteressant zu sein. Als wäre alles schon und schön gelöst, werden zahlreiche Bücher veröffentlicht, die eine aktuelle Theorie der neuen Medien versprechen, währenddessen laufen täglich Familientreffen, Plenen und Diskussionsrunden schief, denn der Akt des Sprechens, der in solchen Versammlungen ausgeführt wird, benötigt ungefähr fünfundvierzig Muskeln, die figurativen erfordern dennoch mehr Geduld als Willen.
Für diejenigen, die tausend Tode beim Sprechen gestorben sind, ist Katharina Lüdins erster Film eine erfrischende Erinnerung, dass die Bewegtbilder sie nicht vergessen haben. “Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag,” noch ein auf Ingeborg Bachmann verweisender Film in den letzten Jahren, neben Milena Czernovsky und Lilith Kraxners Beatrix (2021), stellt eine mögliche Einlösung eines Versprechens dar, das sich langsam, aber sicher entwickelt hat. Das Versprechen eines deutschsprachigen Kinos, dessen Niveau sich in einer Tradition verankert, diese dennoch weiterentwickelt, variiert und – in Momenten – ablehnt; nicht um sich von ihr fernzuhalten, sondern im Sinne einer Aufhebung, die sie weiterverarbeitet, sie zu unbekannten Orten führt. Die Sprache des internationalen Kinos ist die der nationalen Produktionen, die sich trotzdem auf eine Unmenge Regisseur*innen beziehen, die das Vokabular eines cinematischen Modernismus entwickelten. Deutschland und Österreich, egal mit welchen Namen sie benannt und mit welchen Theorien sie untermauert werden, schufen ihre Varianten davon, die Schule machen und Einfluss immer noch besitzen. Nationalität und Orte sind selbstverständlich bloß heuristische Mittel. Diese Filmemacher*innen eint eine Reihe von Eigenschaften, deren hervorstechendste vielleicht die von D. W. Griffith beschriebene ist, dass sie die Schönheit des rauschenden Windes in den Bäumen zeigen.
Lüdins Geschichte einer Familie fügt sich zu diesem diskursiven Raum nicht willkürlich hinzu, sondern durch die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um den profilmischen Raum nach der eigenen Vision zu gestalten. Inwiefern die Geschichte der Zentralpunkt ist, lässt sich durch die konzeptionelle Idee der Umgebung verstehen, der von Anfang an den architektonischen Raum, sprich: die ausgewählten Plätze, in denen die Figuren sich bewegen, abformt und ihn zu einem Schauplatz der Unkommunizierbarkeit umwandelt. Solche Unverbindlichkeit muss paradoxerweise vermittelt werden. Merit (Jenny Schily) ist Mutter, jedoch ist sie im Film chronologisch zuallererst Schauspielerin, die aus dem Fenster schaut, und sich nicht berühren lässt. Ihre Tränen sind Wirkungen, Effekte, deren Ursache, wenn es denn eine gibt, zur Familie führt. Diese Beschreibung täuscht, nämlich weil sich die Familie in ihrer Handlungsachse selten trifft. Vorbeilaufen ist die designierte Aktion; sogar wenn Menschen im selben Raum stehen, fragmentiert der Blickwinkel Merit von Eva (Anna Bolk), ihre Partnerin, und isoliert sie in höhlenartigen Nahaufnahmen, die die Bewegung ihrer Körper akzentuiert, weswegen die Nähe zum Gesicht nicht als Identifikationsmechanismus fungiert. Sobald die Partner*innen zusammen sind, läuft Merit aus der Einstellung heraus, entscheidend und machtvoll. Die Geschichte erklärt sich wortlos, kündigt sich an, ohne ihr Geheimnis zu offenbaren, zumindest nicht, wenn sich die “Erzählung” prachtvoll nur als das Gesprochene vorgibt.
Gleichwohl bleibt dieses Element erfreulicherweise beibehalten und punktuell ausgesetzt. Die erste Szene, ein Beispiel für den Kuleschow-Effekt, der dann durch die Struktur des Films selbst analysiert wird, wird mehrfach mit Sequenzen von Stille, Bewegungen und Gesprächen nachgestellt.. Die eröffnende Konversation zwischen Lion, Merits Sohn, gespielt von Lorenz Hochhuth, seiner Freundin Rose (Pauline Frierson), David (Godehard Giese), einem Freunden von Merit, und Joachim, einem Schauspieler (Wolfgang Michael) ist anspruchsvoll und gleichzeitig mit Filmgeschichte angereichert. Ambitioniert, denn es ist selten, dass eine explizite Absichtserklärung verspielt mit den Dialogen der Figuren gemischt wird. Dies bereitet den Boden für das, was der Film aufzubauen versucht. Geschichtlich gesehen darf man zurückkehren zu geladenen politischen Aussagen von Godard-Filmen, dennoch ist der nähere Name der der Angela Schanelec, die in ihrem ersten DFFB Langfilm “Ich bin den Sommer über in Berlin geblieben” (1993) äußerte, was sie filmisch vorhatte. In diesem ging es um den Klang der Musik, an die nicht erinnert werden kann, die dann jemand aber singt und sich irgendwas zusammenfügt. Ein Moment der Wahrheit wird dadurch gefunden. Bei den Aussagen von „Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag“ geht es um Auslassungen. Normative, darüber, was man über Filme sagen sollte, als Regisseur*in und damit auch als Publikum und Kritiker*in. Und was Film dürfen sollte. Die Antwort einer der Figuren ist durchaus gewagt und trotzdem realistisch. Er sollte mehr dürfen, als er darf.
Dass dieses Gespräch Wolfgang Michael als Anstifter hat, der seine erste Kinorolle bei Schanelecs erstem Film hatte, und der an der Seite von ihr und Bolk ein Liebesdreieck in “Das Glück meiner Schwester” (1995) spielte, ist weniger kurios als der Inhalt der Diskussion, der von einer Fragerunde zwischen einer Regisseurin und einem Journalisten handelt. In diesem wird das Recht, Filme grundsätzlich nicht zu veranschaulichen, verteidigt. Ob die Figuren über einen echten Vorfall reden, ist unbekannt, jedoch trifft es eine Haltung, die Regisseur*innen wie Chantal Akerman und Angela Schanelec vertreten, nämlich jene, die den Film als eine Antwort an sich betrachtet. Mehr Erläuterung geht nicht. Lüdin gibt sich mit dieser Absichtserklärung nicht zufrieden, es gilt ja diese Zustände zu prüfen und damit zu spielen, da es klar ist, dass das, was Kino dürfen sollte, sich nicht mit einer bloßen Zeile entwickeln lässt. Die Figuren an sich stehen herum als hätten sie Angst vor Auslassungen, dem Zustand des Nicht-Redens, der mehr aussagt, als das, was Menschen sagen können. Ihre Aktionen geschehen deswegen wider Willen, das Sprechen heißt im Aufeinandertreffen zweier Körper weder Befreiung noch Entfremdung, sondern ein In-Sich-Verwickelt-Sein. Geteilte Räume weder unbedingt als Möglichkeit noch als Versprechen.
Lüdins Verspieltheit erlaubt ihr, die Grenzen der Auslassungen zu testen und dabei zu fragen, inwiefern es politisch wertvoll ist, sich über gewisse Dinge zu äußern, mit all den von Blut gefärbten Worten. Zwei Brüche finden in der Erzählung statt, der eine formal, der andere bezüglich des Empfängers eines Bekenntnisses, das gehört werden sollte. Die Aussagen erfüllen die ungesehenen Momente, der Subtext wird teilweise zum Text. Dennoch verändern diese Sätze wenig, ihr dramatischer Gehalt wird heruntergespielt. Die bloße Kommunikation reicht nicht aus, gehört zu werden ändert die Erzählung nicht, weil die Schaden schon angerichtet werden. Der filmische Raum wurde schon lapidar definiert, und dennoch wird die Politik dahinter, die der Zeugenschaft, dem Publikum mit kompositorischer Klarheit vermittelt. Die Verantwortungsübertragung erfolgt wortvoll, künstlerisch gekonnt; Lüdings Leistung gehört zu keiner hypertheoretisierten Schule, weder jene in Hamburg, noch in Berlin, noch in Regensburg; sie zeichnet ihre eigene Linie im deutschsprachigen Kino, indem sie Fragen aufgreift und gleichzeitig ihre eigenen aufwirft. Manchmal braucht es nur ein Bild, um zu wissen, mit wem man es zu tun hat. “Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag” zeigt fast zwei Stunden an Bewegtbildern schöner Feinsinnigkeit, begleitet von einem schlagenden Herzen, manchmal hörbar, doch immer spürbar.