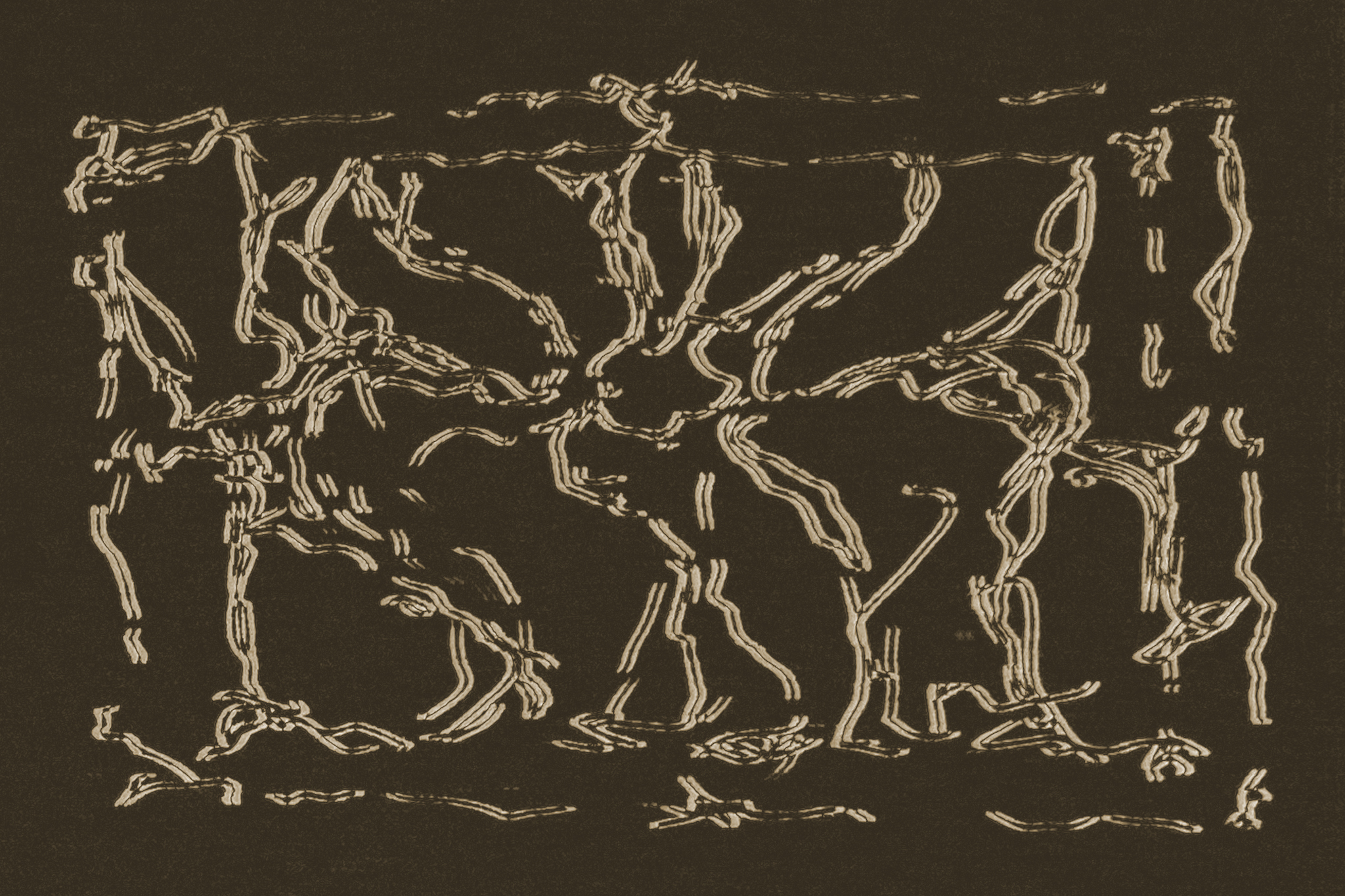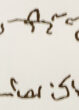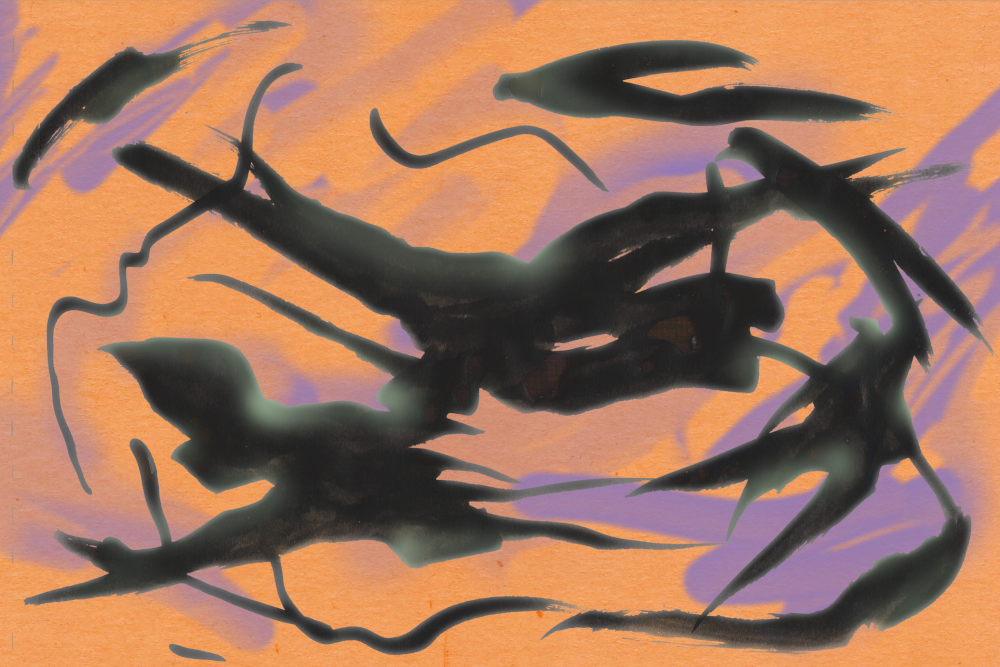
Horse Opera
In Horse Opera, dem neuen Film der Multimedia Künstlerin Moyra Davey, wird das Linear-Narrative durch das Repetitiv-Alltägliche ersetzt. Die Filmemacherin dokumentiert ihre häusliche Umgebung und ihre Alltagsroutine über die Pandemie-Jahre mit ihrem Smartphone – ein sehr persönlicher Film voller monotoner Melancholie und humorvoller Tabulosigkeit. Der Film lässt sich nicht in eine Interpretationsschleuse drängen – im Vergleich zu Dearest Fiona, der auch auf dem Mittel der Bild-und Tonschere beruht und in der diesjährigen Forum Sektion der Berlinale lief. Trotz einem zunächst arbiträr scheinenden Zusammenspiel beider Ebenen, weist dieser doch immer mehr auf ein Grundthema hin. Das ist bei Davey widersprüchlicher, aufgegliederter und dennoch durchgreift den ganzen Film ein simples, verbindendes Element – die Künstlerin als Zentrum der zusammengesetzten filmischen Welt. Die Filmemacherin als Rumpf des Films, auf den alle Glieder zurückzuführen sind: ihre häusliche Umgebung, ihr Blick in den Garten, ihre Tiere, ihre Musik, ihre Stimme im Voice Over, ihr Körper im Bild, ihr eigenes IPhone als Kamera. Eine absolute Intimität, die die Grenze zu einem materialistischen Narzissmus schon überschritten hat, sich dann aber doch wieder in reiner Naturbetrachtung anonymisiert.
Moyra Davey führt das im experimentellen Film relativ verbreitete Mittel der Ton-und Bildschere in die Extreme. Sie wird zu einem unbehaglichen Spagat, wobei die Beine weit auseinander grätschen, auf verschiedenen Böden, sich aber doch nie aus ihrer Hüftachse heben. Die verbogene Pose des Filmkörpers ist lustig anzusehen, in seiner grotesken Selbstverständlichkeit, und manchmal tut es weh beim Betrachten. Als würden sich Augen und Ohren in ihren disparaten Sinneseindrücken voneinander weg bewegen und das Gehirn ratlos zurücklassen, überfordert mit der Unvereinbarkeit der Informationen. Die Bildebene taumelt unspektakulär durch den häuslichen Alltag, sehr nah an allem dran; während die Tonebene penetrant wirkt, wie sie sich monoton durch den ganzen Film zieht. Sie ist der Teil der Schere, der am meisten an den Nerven sägt. Der Wunsch nach Sinnzusammenhang zieht und spannt sich im Widerwillen. Der Film wird zu einem Stream of Unconsciousness, der die Betrachtenden und – mehr noch – Zuhörenden in einen tranceartigen Zustand versetzt. Eine Provokation des Arbiträren?
Die Kameraperspektive ist vornehmlich ein Blick nach draußen in den Garten und auf die weiter entfernte Pferdeweide, durch die Linse eines IPhone12 Pro, gekoppelt mit einem Teleskop. Die Bilder ähneln in ihrem Charakter einer Tierdoku in der Form eines Homevideos1Mit Ausnahme des Voiceovers. . Sowohl die Tiere im Garten, als auch die Objekte in der Wohnung werden nahezu inseriert – ein sehr intuitives Dokumentieren der Dinge. Das Gesehene wird extrem nah herangeholt, durch die farbintensive Smartphone-Ästhetik und die teleskopische Nähe-Illusion. Der ständige Blick nach draußen trägt eine gewisse Melancholie in sich, denn es wird auch betont, dass diese Unmittelbarkeit nur eine optische Suggestion ist. Die Perspektive durch das Fenster wird zu einer Metapher für den Zustand der Isolierung während der Pandemie2 Der Film wurde im Zeitraum von 2019-2022 gedreht.. Die pandemische Erfahrung der Distanzierung ist auch eine zutiefst visuelle. Die Aufnahmen, die durch das Teleskop entstanden sind, eröffnen einen Wahrnehmungsraum im Körper des technischen Geräts. Sehen oder Filmen bekommt eine eigene Materialität. Der Sehakt selbst wird als solcher sichtbar gemacht und zum nach Verbindung strebenden Raum zwischen Innen und Außen, zwischen Subjekt und Welt; einem Raum der Sehnsucht – die Begrenzungen des Sichtfeldes des Teleskops als schwarze Ränder der Isolation. In diesem Sinne ist es auch symbolisch, dass ein Smartphone als Kamera verwendet wurde – war es doch das Visuell-Virtuelle des Bildschirms, das den wahren menschlichen Kontakt ersetzt hat und für die Verbindung mit der Außenwelt sorgte.
Die Tatsache, dass das Bild durch zwei Aufnahmemedien entstanden ist, durch zwei Linsen, wird nicht kaschiert – das begrenzte, runde Sehfeld einer Kreisblende wird zum prägnanten formalen Mittel mit poetischem Potenzial. Manchmal, wenn die Handykamera leicht verrutscht, ist es fast, als würde sich ein Auge schließen. Ränder werden unscharf und verschmälern sich. Licht bricht sich in den Wimpern beim Blinzeln. Das Auge der Zusehenden ist das Auge der Filmemacherin, die auf ihre häusliche Umgebung blickt. Die Smartphone Kamera erzeugt eine rohe und poppige Ästhetik; die Farbsättigung ist intensiver als die Wirklichkeit und die Auflösung schwammiger. Davey scheut sich nicht davor, diese Mängel zu zeigen und gerade daraus eine spontanere Poetik entstehen zu lassen – ein durch Bewegung springender Auto-Fokus und Gegenlicht erzeugen zufällige Momente der Poesie: Unschärfe und Blendenflecken.
Die suchenden Kamerabewegungen mögen an Jonas Mekas erinnern, wobei Davey eine Sublimierung des Gefilmten noch ferner liegt. Bei beiden finden sich intuitive Kameraschwenks und eine absolut subjektive Kamera, die kleine Alltagsmomente impressionistisch aufnimmt. Bei Mekas rasen die Bilder in einer schnellen Montage vorbei, wie eine Akkumulation flüchtiger Momente. Bei Davey sind es wiederum die langsamen Einstellungen, die ihrerseits einen Bestandsaufnahme-Charakter erlangen, der im Vergleich materialistischer ist. Auch wird Vergänglichkeit nicht durch die Schnelligkeit der Montage und Kameraführung erzeugt, sondern durch statische Einstellungen von mit Staub bedeckten Schallplatten, die von der Nachmittagssonne beschienen sind. Die beobachtenden Tieraufnahmen verlieren im Laufe des Films ihre kuriose Wirkung und den Witz, der an manchen Stellen in Überschneidungen mit dem Voice Over entsteht. Was aber auch bei wiederholtem Zeigen nie seine provozierende Qualität verliert, sind die Close Ups pinkelnder Pferde. Sie führen den patriarchalen Voyeurismus ad absurdum. Dieser wird bewusst ins Lächerliche invertiert und die Lust am Schauen verdorben, indem die Sexualisierung ins Eklige führt. “In a bastard, standardized, conformist, sick society, perversity becomes a force of liberation.”3 Jonas Mekas, Scrapbook of the Sixties. Writings 1954-2010. Leipzig 2015, S. 13.
Klanglich befinden wir uns im Innenraum, wobei der Sound der Vinylplatten nie ganz seinen Charme entfalten kann. Es hallt dumpf wie von fern, nostalgisch aus einer vergangenen Zeit. In diesem Kontext steht der monotone Sprechstil des Voice Overs, in dem Davey autofiktive Geschichten von Partys einer gewissen L erzählt – denn dieser ist auch die Stagnation und Monotonie, die die Pandemiejahre mit sich brachten. Davey geht langsam und rezitierend in den Räumen ihres Hauses auf und ab; durch ihre Küche, ihr Arbeitszimmer, ihr Schlafzimmer; immer wieder aus dem Off ins Off. Der Hintergrund des Zimmers im Fokus, sie im Vordergrund, unscharf, oft auch von fern; die Kamera ist statisch, sie bewegt sich.
Diese Einstellungen erinnern an die Statik der Aufnahmen in der New Yorker Subway in Akermans News from Home, die Davey in ihrem Essay Caryatids & Promiscuity als fesselnd4Moyra Davey: Index Cards, London 2022, S. 146. beschreibt – die Kamera konkurriert nicht mit der Beweglichkeit der fluktuierenden Passagiere und lässt den Subjekten ihre Entscheidungsvollmacht, aus dem Bild zu treten. So taucht die Filmemacherin in Horse Opera ausschließlich als aktives Subjekt im Bild auf, wie eine Passantin, die sich der Kamera bewusst ist, diese aber kaum beachtet in ihrer großstädtischen Arroganz. Sie steigt in ihr Bildfeld und wieder aus ihm heraus, wie in eine Untergrundbahn; zyklisch schwärmend wie das Kommen und Gehen von New Yorker Menschenmengen. Tine Rahel Völcker bemerkt die fehlende Lenkung und Fokussierung des Kamerablicks in News from Home: “Die Kamera hält niemanden fest, sie enthält sich jeder Okkupation, Verfolgung.”5 Tine Rahel Völcker: Das Verschwinden von Chantal Akerman, Leipzig 2020, S. 63-64. Gerade darin liegt aber auch die sanfte Wehmut dieses Films verborgen – alles und jede.r geht vorüber, wird atmosphärisch aufgenommen, eine Weile auf den Sichtgleisen getragen und wieder losgelassen.
Der Film ist voll vom Trubel des Lebens, von Bahnenlärm, der die ferne Stimme der Mutter – die Stimme von Akerman selbst, überfährt; aber auch von seinem Vorübergehen, das in der letzten Szene in absolute Distanz verläuft. Ganz still ist diese, nur von Möwenflug und ihren fernen Schreien begleitet, die durch das Verblassen der Skyline umdämpft werden6 Wie auch am Ende von Horse Opera ein Pferd zu 1-2-3 von The Chimes in den nebligen Hintergrund trabt.. Es ist ein vergangenes New York in verblasstem Super 8-Pastell – wie Akerman einmal in einem Interview sagte: “C’était un certain New York. Qui n’existe plus.” So wie die jungen New Yorker Partyjahre vergangen sind, von denen die Ich-Erzählerin in der rezitierten Erzählung in Horse Opera schwärmt. Das Voice Over versickert hier nicht unter dem Sound der Alltagsszenen, vielmehr scheint das Vergangene penetrant wieder in Erinnerung gerufen zu werden, wobei Pferde zu sich bäumenden, tanzenden Clubgängern werden, die von L, der Protagonistin der Erzählung beobachtet werden. Das Abwesend-Werdende zeigt sich in den markanten Stackato-Pausen, in denen das erzählte Leben herunterfällt und auf den Boden der pandemischen Einsamkeit trifft. Im Aufprall schlägt Tanzrausch auf Stillstand. Eine befremdliche, dumpfe Ferne liegt über den betrachteten, eigentlich vertrauten Haustieren; friedlich und beunruhigend zugleich. Diese Stimmung erinnert an die letzte Einstellung in News from Home, in der sich die Kamera mit einem Schiff von der New Yorker Küste entfernt; ganz langsam, ganz still.
Tine Rahel Völcker bezeichnet News from Home als “Gegenstück zum geschlossenen Topos des Zimmers, in das sich eine junge Frau zurückzieht […] – des Zimmers als Gefängnis und Einschluss in den eigenen Körper und die eigene Geschichte […].”7 Tine Rahel Völcker: Das Verschwinden von Chantal Akerman, Leipzig 2020, S. 54. Genau das nimmt Davey mit in das private Zimmer – also nicht wie in La chambre (1972), wo Akerman im Bett liegt, während die Kamera sich immer wieder zirkulär an ihr vorbei bewegt; sondern die Fluktuation findet in Horse Opera in den Innenräumen statt. Doch kurz danach folgt eine Reihe von Szenen, in denen eine Pferdebrust – als Stellvertreter des jungen Körpers in Daveys Erzählung – von Spinnenweben überspannt ist.
In Martha Roslers Semiotics of the Kitchen, einer performativen Videoarbeit, wird die kommerzialisierte, stereotype Rolle der Frau in einer modernen kapitalistischen Gesellschaft kritisiert. Haushaltsgeräte werden in der Reihenfolge des Alphabets vorgestellt und ihres Zwecks entfremdet, indem dieser nur exemplarisch vorgeführt, statt wie in einer Kochshow ausgeführt wird. Dieses Prinzip lässt sich auch in Horse Opera in den zunächst undurchsichtigen Tätigkeiten finden, die repetitiv entleert scheinen – wie das ständige Aufrollen von Bandagen oder das ritardierende Diktieren, ja das selbstvergessene Wiederkäuen eines bereits aufgenommenen Textes. In Horse Opera wird also auch diese Monotonie des Alltags gezeigt und gleichzeitig hallt die Entsemantisierung der zweckgebundenen Haushaltsaufgaben leicht nach, was Semiotics of the Kitchen als Hauptprinzip zugrunde liegt.
Die Sublimierung einer Überästhetisierung ist dem Vokabular dieses Films fremd, aber doch, wie unbekümmert und zufällig, taucht das Schöne auf. Wie ein Versehen schleicht es sich ins Bild und ist doch nicht ungewollt. Es findet sich in den recht schwärmerischen Bildern sich räkelnder, aufbäumender Pferdekörper im Sonnenaufgang – wie sich das Licht im Dampf der muskulösen Torsi reflektiert. Und in den blauen Rahmungen um die Silhouette des Hundes, der sich tapfer durch vereisten, einbrechenden Schnee kämpft. Das Schöne ist nur noch ein Echo des Sublimen, wobei das Arbiträre und das Radikal-Monotone zum Transzendenten wird. Das Hässliche mischt sich mit dem Schönen und wird in der Wertung enthierarchisiert. Das hat seine Wurzeln bereits im französischen Symbolismus, insbesondere in den Gedichten von Baudelaire und Rimbaud8hierzu vgl.: Et tout ce corps remue et tend sa large croupe/ Belle hideusement d’un ulcère à l’anus. Auszug aus Rimbauds Vénus anadyomène, in: Michel Simonin (Hrsg.): Rimbaud. Poésies complètes 1870-1872, Paris 1998, S. 83.. So wird in Horse Opera das Zelebrieren der idealen Proportion muskulöser Pferdekörper durch Großaufnahmen von Pferdegenitalien beim Pinkeln begleitet.
Eine verweste Ratte im Gras, schillernde Fliegen auf ihrem ausgetrockneten Körper und ein Schmetterling, direkt daneben, der ab und zu sichtbar wird, wenn er synkopisch zum Zittern der Kamera seine Flügel öffnet.
Notes
- 1Mit Ausnahme des Voiceovers.
- 2Der Film wurde im Zeitraum von 2019-2022 gedreht.
- 3Jonas Mekas, Scrapbook of the Sixties. Writings 1954-2010. Leipzig 2015, S. 13.
- 4Moyra Davey: Index Cards, London 2022, S. 146.
- 5Tine Rahel Völcker: Das Verschwinden von Chantal Akerman, Leipzig 2020, S. 63-64.
- 6Wie auch am Ende von Horse Opera ein Pferd zu 1-2-3 von The Chimes in den nebligen Hintergrund trabt.
- 7Tine Rahel Völcker: Das Verschwinden von Chantal Akerman, Leipzig 2020, S. 54.
- 8hierzu vgl.: Et tout ce corps remue et tend sa large croupe/ Belle hideusement d’un ulcère à l’anus. Auszug aus Rimbauds Vénus anadyomène, in: Michel Simonin (Hrsg.): Rimbaud. Poésies complètes 1870-1872, Paris 1998, S. 83.