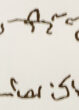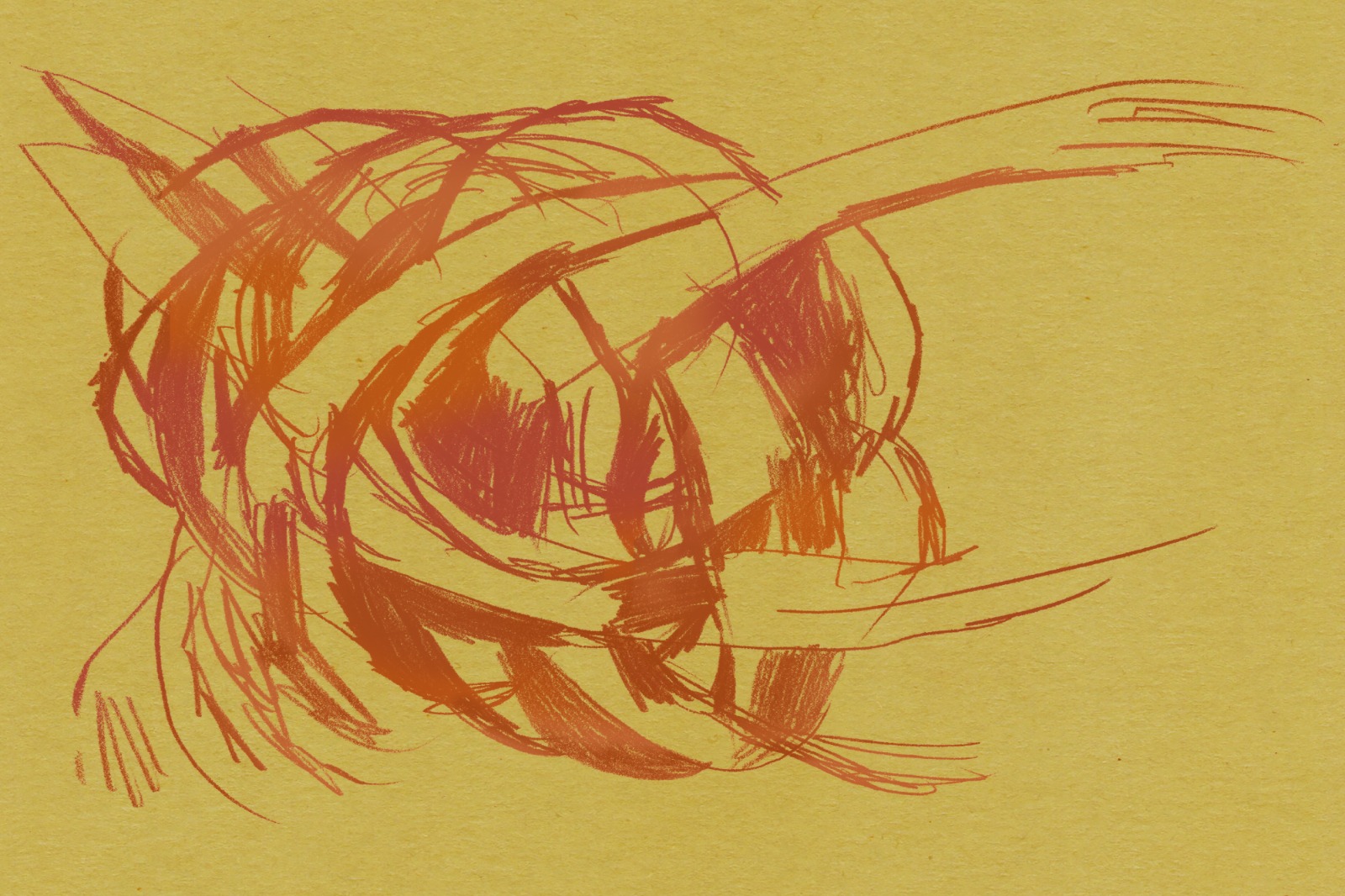
Ein schöner Ort
An verschiedenen Punkten in Katharina Hubers „Ein schöner Ort“ sind Stimmen von Männern zu hören. Sie sprechen von Raketen und Raumstationen und davon, wie wir den Menschen denken sollen. Die Mischung aus rücksichtsvollen philosophischen Gedanken und der Praxis von Männern zeigt den historischen Ehrgeiz als ein seltsames, schwer zu bändigendes Tier. Diese Art von Ambition tendiert zur Figur des prometheischen Mannes, der sich allem widersetzt, was seinen Willen unterdrücken will, während er gleichzeitig von Schicksalsversprechen motiviert wird. Solch eine Erzählung und die Figurationen, die sie in die Welt bringt, sie zu Maschinen macht, finden ihren Ausdruck in Diskursen, Büchern, Fotos und Filmen der ganzen Welt. Eine der am meisten studierten Darstellungen ist das Gemälde John Gasts von 1872. Der Ehrgeiz wird dort als „Fortschritt“ bezeichnet, was qualifiziert werden muss, denn Fortschritt ist in dieser Weltanschauung immer der von jemand Bestimmtem. Gast nennt ihn „American Progress“. Columbia, die gigantische Frau, die von Rechts nach Links läuft, ist die Verkörperung der USA, auf ihrem Kopf liegt “The Star of the Empire.” Sie führt Siedler in Wagen, Zügen und Postkutschen; in der einen Hand trägt sie ein Schulbuch, mit der anderen verlegt sie einen Telegrafendraht. Die Idee, die sie mitbringt, ist nichts anderes als das „Manifest Destiny“, mit der sich die Siedler ihren Weg nach Nordamerika bahnten und dabei ihre Taten romantisierten.
Es gehört zur Romantisierung, dass Columbia, Amerika, eine Frau ist, da sie ein Ideal darstellt, unerreichbar und dennoch wegweisend für die Zukunft. Und wenn nur die riesige Frau im Mittelpunkt steht, besteht aufgrund ihrer symbolischen Qualitäten die Gefahr, dass man übersieht, dass dieses riesige Ideal im Begriff ist, die ängstlich vor ihm davonlaufenden Menschen links im Bild zu zertrampeln. Die Richtung des Lichts zeigt zweifellos, dass der Weg, den sie bereits zurückgelegt hat, voller Licht und Zivilisation ist, eine Folge der Bewegung der Kolonisatoren. Die anderen, die oft nicht gesehen werden, bedeuten das Gegenteil, was natürlich etwas ist, das zerstört werden muss. Die seit langem angeprangerte Logik der Aufklärung wäre das Äquivalent in Europa, aber das Phantom von Kolumbien verfolgt all jene, die solche Ideale nicht oder nur mit minimalen, kosmetischen Änderungen revidieren. Der Fortschritt in einer globalisierten Welt lässt die Mehrheit in der Dunkelheit zurück, die ihr generationenübergreifendes Grauen, das Trauma, vom Licht verschont geblieben zu sein, auf die ungewöhnlichste Weise verarbeiten muss. Und das nur, wenn sie bis jetzt überlebt haben.
“Ein Schöner Ort” lässt keine Zweifel darüber unberührt, dass das Phänomen der immer nach vorne schwankenden Bewegung Überreste zurücklässt, welche die Modernist*innen das Unbewusste bezeichneten, und das bis heute in komfortablen Sofas der zivilisierten Welt als selbstverständlich und wichtig gilt. Auf Psychogelaber hat aber Hubers ambitioniertes Debut gar keinen Bock, vielmehr geht es ihr darum, inwieweit sich die Instabilität der aktuellen Situation figurieren lässt. Die Antworten auf ihre Forschungsfragen führen sie dazu, flüchtige Bilder starker Ikonizität zu komponieren. Die ersten Worte, die im Film gesehen werden, “Eine Dorfgeschichte von Acker” sind wortwörtlich zu interpretieren. Das Dorf, und all seine Komponenten, Teile, Menschen und Tiere, haben eine Geschichte zu erzählen, die oft in die Idealisierung verfällt. Das Märchen, das Huber geschrieben hat, sehnt sich andererseits nach einer Schmutzigkeit ohne die moralische Überlegenheit, die mit ihrer Darstellung einhergeht, eine Gewalt, die vertraut bleibt, auch wenn sie immer noch gefährlich ist. Die ersten Worte des Films “Eine Dorfgeschichte von Acker,” lügen nicht, dennoch bemüht sich der Film, das Dorf durch Zeichen zu verlassen, Zeichen, die eine unsichtbare Auseinandersetzung zwischen den beiden Polen des Columbia-Gemäldes gestalten, ja diese unausweichlich machen. Dafür werden zwei Figuren skizziert, Güte (Clara Schwinning) und Margarita (Celiné De Gennaro), deren im Film dargestellte Momente vor figurativen Erfindungskraft strotzen. Die Nahaufnahme Gütes, die der ersten menschlichen Figur vor den Augen liegt, zeigt Bestürzung, Beunruhigung und ein Lachen in Sekundenschnelle. Kurz zuvor: ein brennender Wald im Fernsehen und dann noch ein anderer, noch am Leben und doch dunkler, innerhalb dessen sich Güte befindet.
So werden die Figuren gezeichnet, im Rahmen eines diagonalen Blickwinkels, der oft mit den Linien des profilmischen Raumes komponiert, oft auch in 90 Grad, um das Ikonische seiner Bilder zu betonen. Diese Besonderheit verleiht den Bildern eine pikturale Integrität, die durch die Montage immer wieder in Frage gestellt wird. Dahinter verbirgt sich keine feste Sicherheit, sondern ein Gefühl des Verlorenseins. Wenn Güte spät im Film ausruft „Ich bin doch da!“, tut sie das weniger, um den Angreifer aufzuhalten, sondern um ihre Existenz in dieser Realität zu verankern. Auch das Leben der Figuren steht auf dem Spiel, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, weshalb sie sich dem Blick entziehen. Sie stellen sich ungern in den Mittelpunkt, häufig zwischen Bäumen, Blumen und Menschen, doch ständig nach Unsichtbarkeit strebend. Oft gesessen, inmitten eines Gesprächs aufgefangen, die Figuren formen einen Chor im Schnitt, der eine Figur mit den anderen verbindet und gleichzeitig von ihnen gewaltig trennt, so wie eine Figur in ihrem Haus durch einen Baum oder einen Blumenstrauß in der Komposition gestört werden kann, gerahmt in mehr als einer Hinsicht. Da die “Anderen” im Film Blumen, Tiere, Fenster und Radios sind, besteht der Film aus Stimmen, die besser als Frequenzen verstanden werden sollten, als dass sie Stimmen von Menschen sind. Statt Kapiteln besitzt die Erzählung zehn Sätze, die eigenständig durchgeführt werden und die doch in ihrer Vollständigkeit das Unbehagen des Dorfes skizzieren können.
Da die symbolische Konstitution des Films, über etwas zu sprechen, das nicht erscheint, konsequent verfolgt wird, stehen die Menschen, die Bewohner*innen dieses Dorfes, als figurative Geister da, deren Abwesenheit – mit Ausnahme einer Barszene – und Tod den ständig zu hörenden Radiosendungen nicht unähnlich sind. Die Rede ist vom menschlichen Streben nach mehr, von dem Übermenschen, der sich als etwas Besseres ausgibt, während Menschen von ihm reden. Güte will sowohl raus als auch eben nicht, ihre Einstellung bleibt zweifelsvoll, nicht bezweifelt. Sie sprengt die Ställe in die Luft und zieht sich mehr in die Natur zurück. Die Feinde werden suggeriert, nicht so gezeigt, als wären sie alle böse. Die figurative Ökonomie von “Ein schöner Ort” zwingt ihre Charaktere dazu, ohne Maske herumzulaufen, manchmal ohne Hosen. Der Wolf (Jannik Mioducki) steht über den Frauen im Bett, im Wald und während sie ein rudimentäres Bad nehmen, doch er ist Teil der ungewissen Umstände, die sie in die Schwebe bringen. In „Ein schöner Ort“ sind diese Figuren ebenso bedrohlich wie lächerlich, was ihre unentschlossene, sanfte Melancholie hervorbringt.
Denn sie verstecken sich in den Schatten einer raketenförmigen Columbia, und in ihnen finden sie unvorhersehbare Bewegungen und Gesichtsausdrücke. Die Kompositionen, die Jesse Mazuch und Carmen Rivandeneiras aufbauen, harmonieren durchaus erheblich mit der Lichtgestaltung von Tim Schuback und Fabian Rieke, die mit Seitenlichtern die Gesichter und Körperformen der Figuren in Einklang bringen mit deren Zweifeln und gelebter Ambivalenz. Klugerweise trägt der Film seine formale Gestaltung mit Selbstbewusstsein vor, das Komische koexistiert mit dem berechtigten Understatement um die beiden architektonischen Räume des Films zu erschaffen, das Dorf und den Wald, die beide düster, nihilistisch bleiben, wenn auch nicht ohne Brüche, die das Leben unter den Giganten ebenso vertraut wie unerträglich machen. Hubers “Ein schöner Ort” erkennt die Dunkelheit dieser unserer Lage an, durch das Prisma von Körpern, die in ihrer Plastizität bemerkt werden; verloren und doch vertraut mit dem Weg, auf dem sie gehen. Was tun im Angesicht des Riesen? Singen und Lachen, Raketen werden trotzdem abgefeuert. Und wenn sie unweigerlich scheitern, obwohl selbst das fraglich ist, wird das Lachen zu einer Aussicht, bereit, im Licht genossen zu werden.